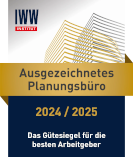17.08.2021 · IWW-Abrufnummer 224114
Oberlandesgericht Düsseldorf: Urteil vom 24.06.2021 – 5 U 268/20
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Oberlandesgericht Düsseldorf
Tenor:
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg ‒ Einzelrichterin ‒ vom 26.11.2020 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 31.733,74 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14.3.2014 Rechtshängigkeit zu zahlen;
Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, den Namen „Sch…“ und/oder „Sch…“ auf seiner Homepage zu führen, insbesondere unter dem Button „Partner.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz tragen die Klägerin zu 40% und der Beklagte zu 60%. Die Kosten des Rechtsstreits zweiter Instanz trägt die Klägerin.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
1
GRÜNDE:
2
I.
3
Der Beklagte hat als Bauherr und Architekt ein Bauvorhaben in der M…straße … in Sch… ausgeführt und dabei die Klägerin mit der Durchführung von Arbeiten ‒ insbesondere Beton- und Mauerarbeiten ‒ beauftragt. Die Klägerin hat mit der Klage restlichen Werklohn gefordert.
4
In einer Mail vom 27.2.2012 an die Klägerin bezeichnete der Beklagte das Bauvorhaben als „Sanierung und Erweiterung eines Wohnhauses zu 5 WE + Gewerbeeinheit“. Dabei hatte er vor, selbst in das Objekt einzuziehen, was er später auch umsetzte.
5
Die Klägerin hat die von ihr angeblich erbrachten Leistungen unter dem 30.4.2013 auf Stundenhonorarbasis zuzüglich Material abgerechnet. Mit einer am 14.1.2014 erstellten Schlussrechnung hat sie hilfsweise nach Massen und Einheitspreisen abgerechnet. Die Klage wurde dem Beklagten am 13.3.2014 zugestellt.
6
Wegen der Einzelheiten wird gem. § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.
7
Mit dem am 26.11.2020 verkündeten Urteil hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg, Einzelrichter, den Beklagten unter Klageabweisung im Übrigen verurteilt, an die Klägerin 31.733,74 € nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 13.3.2014 zu zahlen. Weiter hat es den Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, den Namen „Sch…“ oder „Sch…“ auf seiner Homepage zu führen, insbesondere unter dem Button „Partner“.
8
Die Klägerin habe einen restlichen Vergütungsanspruch in Höhe von 31.733,74 €. Die Parteien seien sich einig gewesen, dass die Klägerin Bauarbeiten gegen Vergütung habe ausführen sollen. Es sei bei einem Werkvertrag ausreichend, wenn die Merkmale zur Berechnung der Vergütung festgelegt seien. Dies sei der Fall, da die Parteien sich geeinigt hätten, nach Einheitspreisen abzurechnen. Dies habe der Beklagte durch die Ausschreibung zum Ausdruck gebracht. Die Klägerin habe dies dadurch akzeptiert, dass sie die ersten Abschlagsrechnungen nach Einheitspreisen erstellt und zum Ende der Vertragsbeziehung ein Aufmaß verlangt habe. Es sei nicht feststellbar, dass bestimmte Einheitspreise vereinbart worden wären. Insofern könne auf die üblichen Preise zurückgegriffen werden.
9
Die angemessene Vergütung betrage 109.049,79 €, wovon das Gericht nach der Beweisaufnahme überzeugt sei. Dabei stütze sich das Gericht insbesondere auf das Gutachten des Sachverständigen G…. Der Sachverständige habe berechnet, dass eine Vergütung von netto 84.706,70 € berechtigt und angemessen gewesen sei. Er habe dabei die durch die Zeugenaussagen ermittelten Umstände über die beengten Bauverhältnisse und die sukzessive vorgelegten Pläne berücksichtigt. Zu dem ermittelten Betrag kämen die Kosten der Baustelleneinrichtung in Höhe von 5.500 € netto hinzu. Zudem könne die Klägerin die Kosten für den Kran berechnen. Der Sachverständige habe klar ermittelt, dass die Materialien nur durch den Kraneinsatz angemessen hätten transportiert werden können. Hierfür setze das Gericht 1.151,28 € und 280,50 € an. Von der ermittelten Vergütung von 109.049,79 € brutto seien die unstreitigen Zahlungen in Höhe von insgesamt 77.316,05 € abzuziehen.
10
Die Klägerin habe im Verlauf des Rechtsstreites eine ordnungsgemäße Abrechnung erteilt.
11
Der Zinsanspruch bestehe erst ab Rechtshängigkeit, da die Abrechnung erst im Prozess erfolgt sei. Die Zinshöhe folge aus § 288 Abs. 2 BGB a.F.
12
Die Klägerin könne nach § 1004 BGB analog verlangen, dass der Beklagte sie nicht als Partner auf seiner Homepage benenne.
13
Mit der Berufung richtet sich der Beklagte gegen das Urteil insoweit, als er zu einer Zahlung von Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verurteilt wurde und nicht nur zur Zahlung von Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Tatsächlich seien von ihm nur Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf die Summe von 31.733,74 € geschuldet. Dies sei angesichts der erheblichen Zuviel-Forderung auch in der Kostenquote zu beachten.
14
Nach dem unstreitigen Parteivortrag sei allein § 288 Abs. 1 BGB einschlägig gewesen, nicht § 288 Abs. 2 BGB. Das Gericht habe zutreffend festgestellt, dass er die Klägerin für ein Gebäude beauftragt habe, in dem er selbst wohne. Feststellungen dazu, dass er in unternehmerischer Eigenschaft gehandelt hätte, seien dem Prozessstoff nicht zu entnehmen. Dies folge schon aus der Klageschrift, wonach er den Auftrag für sein privates Bauvorhaben erteilt habe und die Klägerin Werklohnansprüche aus diesem privaten Bauvorhaben geltend mache. Das Landgericht hätte vor diesem Hintergrund jedenfalls nicht ohne inhaltliche Auseinandersetzung zur Anwendung von § 288 Abs. 2 BGB kommen können. Nur weil er als Architekt „vom Fach“ sei, könne nicht der Schluss gezogen werden, dass automatisch § 288 Abs. 2 BGB anzuwenden sei. Ausführungen, weshalb das Gericht den Vertragsschuss entgegen dem unstreitigen Vorbringen der Klägerin als überwiegenden einer gewerblichen Tätigkeit zuzuordnen bewertet habe, fänden sich nicht. Er habe die Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zum Stichtag 3.12.2020 an die Klägerin gezahlt. Bei Berücksichtigung der erheblichen Zuviel-Forderung im Hinblick auf die Zinsen betrage die Kostenquote in erster Instanz 49% zu 51%, so dass die Kosten gegeneinander aufzuheben seien und nicht nach einer Quote 36% zu 64% zu verteilen seien.
15
Er beantragt,
16
unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Duisburg vom 16.11.2020 ihn zu verurteilen, an die Klägerin 31.733,74 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
17
ihn zu verurteilen, es zu unterlassen, den Namen „Sch…“ oder „Sch…“ auf seiner Homepage zu führen, insbesondere unter dem Button „Partner.
18
Die Klägerin beantragt,
19
die Berufung zurückzuweisen,
20
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil. Unstreitig sei der Beklagte als Architekt aufgetreten. Damit sei unstreitig, dass er Kaufmann im Sinne des § 288 Abs. 2 BGB sei. Das Landgericht Duisburg habe diesen Umstand („Der Beklagte als Architekt“) in dem Urteil benannt. Dieser Sachverhalt sei unter § 288 Abs. 2 BGB zu subsumieren. Der Beklagte habe auch seine Stellung als Architekt genutzt und ein Aufmaß zugesichert. Dies hätte er als Verbraucher nicht leisten können. Der Beklagte habe im Prozess der Stellung als Architekt nicht widersprochen und habe die Stellung als Architekt nutzten wollen, um die VOB/B in den Vertrag einzubeziehen. Da ihm dies nicht gelungen sei, wolle er nun als Verbraucher wahrgenommen werden.
21
Der Beklagte sei selbst davon ausgegangen, als Architekt zu handeln. So habe erst auf Seiten 6 und 8 des Schriftsatzes vom 29.11.2016 vorgetragen, er sei daran gehindert, den in der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer anzumelden. Als Privatmann könne er die Vorsteuer eines privaten Bauvorhabens nicht steuerlich geltend machen. Zudem sei das Objekt teilweise vermietet. Die gewerbliche Vermietung zeige, dass der Beklagte nicht als Verbraucher gehandelt habe.
22
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens im Berufungsverfahren wird auf die wechselseitigen Schriftsätze und Urkunden Bezug genommen.
23
II.
24
Die Berufung ist zulässig und begründet.
25
Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB a.F. auf Zinsen aus 31.733,74 € nur in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 14.3.2014 zu.
26
1.
27
Es steht rechtskräftig fest, dass der Kläger nach §§ 291, 288 BGB auf einen Betrag von 31.733,74 € jedenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten schuldet. Insoweit greift der Beklagte das Urteil nicht an. Nach § 291 S. 1 BGB ist es für den Zinsanspruch nicht erforderlich, dass sich der Schuldner in Verzug befindet.
28
2.
29
Zinsbeginn ist der 14.3.2014. Die Zinspflicht beginnt wegen § 187 Abs. 1 BGB mit dem Folgetag der Rechtshängigkeit (vgl. Palandt-Grüneberg § 291 BGB Rn. 6) Die Klage wurde dem Beklagten am 13.3.2014 zugestellt, vgl. Bl. 23 GA.
30
3.
31
Die Klägerin kann nach § 288 Abs. 1 BGB nur Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verlangen.
32
Nach § 288 Abs. 1 S. 2, 291 S. 2 BGB beträgt der Zinssatz im Regelfall 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Davon abweichend beträgt der Zinssatz für Rechtsgeschäfte, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz vgl. §§ 291 S. 2, 288 Abs. 2 BGB (in der hier relevanten Fassung bis zum 28.7.2014, nachfolgend: „BGB a.F.“). Vorliegend ist seitens der Klägerin nicht substantiiert vorgetragen, dass der Beklagte bei Abschluss des Werkvertrages nicht als Verbraucher gehandelt hat. Die Klägerin hat nicht substantiiert vorgetragen, dass der Beklagte den Werkvertrag im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen hat. Macht ein Gläubiger den höheren Zinssatz des Abs. 2 geltend, hat er zu beweisen, dass der Schuldner nicht Verbraucher nach § 13 ist (vgl. BeckOGK/Dornis, 1.3.2020 Rn. 96, BGB § 288 Rn. 96; MüKoBGB/Ernst, 8. Aufl. 2019, BGB § 288 Rn. 22).
33
Nach § 13 BGB (in der maßgeblichen, bis zum 12.6.2014 geltenden Fassung) ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, wohingegen der Unternehmerbegriff in § 14 Abs. 1 BGB als das kontradiktorische Gegenteil des Verbraucherbegriffs ausgestaltet ist. Für die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Unternehmerhandeln ist grundsätzlich die objektiv zu bestimmende Zweckrichtung des Rechtsgeschäfts entscheidend (vgl. BGH NJW 2018, 153; BGH NJW 2018, 146; BGH NJW 2020, 3786). Es kommt darauf an, ob das Verhalten der Sache nach dem privaten Bereich ‒ dann Verbraucherhandeln ‒ oder dem gewerblich-beruflichen Bereich ‒ dann unternehmerisches Handeln ‒ zuzuordnen ist (vgl. BGH aaO). Dabei fällt auch eine nebenberufliche Tätigkeit unter den Unternehmerbegriff des § 14 BGB (vgl. BGH, NJW 2020, 3786 Rn. 16). Unter einer gewerblichen Tätigkeit versteht man ein planmäßiges, auf eine gewisse Dauer angelegtes Anbieten entgeltlicher Leistungen am Markt unter Teilnahme am Wettbewerb. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich (BGH NJW 2018, 146 Rn. 40).
34
Soweit eine Person in einem geschäftlichen Zusammenhang betroffen ist, der teils ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen und teils einer anderen Tätigkeit zuzurechnen ist, also etwa einen Vertrag schließt, der zugleich unternehmerischen und privaten Zwecken dient („dual use“), handelt sie nur dann nicht als Verbraucher iSd § 13, wenn der unternehmerische Zweck überwiegt (vgl. BeckOK BGB/Martens, 57. Ed. 1.2.2021, BGB § 13 Rn. 49). Bei gemischten Zwecken ist der überwiegende Zweck entscheidend (vgl. MüKoBGB/Micklitz Rn. 52). Der Gesetzgeber hat diese bereits zuvor entwickelte Regel (OLG Bremen BeckRS 2004, 9443 = ZGS 2004, 394 f.; OLG Celle NJW-RR 2004, 1645 [1646]) bei Umsetzung der Verbraucherrechte-RL ausdrücklich in § 13 festgeschrieben (vgl. BeckOK BGB/Martens, 57. Ed. 1.2.2021, BGB § 13 Rn. 49).
35
Für die Abgrenzung maßgeblich sind die jeweiligen Umstände des Einzelfalls, insbesondere das Verhalten der Vertragsparteien (BGH NJW 2018, 150 Rn. 31 und NJW 2018, 146 Rn. 41 jew. mwN). Abzustellen ist auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses beziehungsweise der Abgabe der auf den Abschluss eines Rechtsgeschäfts gerichteten Willenserklärung (vgl. BGH, NJW 2020, 3786 Rn. 17, beck-online). Nach diesen Grundsätzen ist nicht feststellbar, dass der Vertragsschluss hier vorrangig der gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit des Beklagten zuzurechnen war.
36
a)
37
Zunächst folgt ein Handeln als Unternehmer nicht allein daraus, dass der Kläger bei Vertragsschluss eine selbstständige berufliche Tätigkeit als Architekt ausgeübt hat. Ein Handeln „in Ausübung“ der gewerblichen oder der selbstständigen beruflichen Tätigkeit iSv § 14 I BGB setzt voraus, dass es gerade in einem hinreichend engen Zusammenhang mit eben dieser erfolgt (vgl. BGH, NJW 2018, 150 Rn. 38, beck-online). Vorliegend ist unstreitig, dass der Beklagte selbst Eigentümer des Gebäudeskomplexes war und dort u.a. für sich eine Wohnung errichten lassen wollte. Zwischen seiner Tätigkeit als Architekt und dem Umbau des in seinem Eigentum stehenden Hauses zur Eigennutzung besteht nicht ohne weiteres ein tätigkeitsspezifischer Zusammenhang. Denn die Tätigkeit eines Architekten ist üblicherweise durch ein Tätigwerden in fremden Namen geprägt. Das Auftreten als Bauherr, also die Erteilung von Aufträgen in eigenem Namen und im eigenen Interesse, gehört üblicherweise nicht zum unternehmerischen Bereich eines Architekten.
38
Eine Vermutung dafür, dass alle vorgenommenen Rechtsgeschäfte eines Unternehmers „im Zweifel“ seinem geschäftlichen Bereich zuzuordnen sind, besteht nicht ( vgl. BGH, NJW 2018, 150 Rn. 36, 37, beck-online). Vorliegend folgt eine solche Vermutung entgegen der Ansicht der Klägerin nicht aus § 344 HGB. Es ist nicht ersichtlich, dass der Beklagte bei Auftragserteilung Kaufmann iSd § 344 HGB gewesen sein könnte. Gemäß § 1 HGB ist Kaufmann im Sinne des HGB, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Der Beklagte war als Architekt tätig und firmierte ausweislich diverser Mails unter „Planungsbüro R…“ bzw. ausweislich der Anlage K19 unter seinem Namen. Hierdurch hat er kein Handelsgewerbe betrieben. Der Beruf des Architekten ist ein sogenannter freier Beruf. Freie Berufe, Wissenschaft und Kunst betreiben nach ihrem historisch gewachsenen Berufsbild und der Verkehrsanschauung kein Gewerbe iSdes HGB (vgl. Baumbach/Hopt/Merkt, 40. Aufl. 2021, HGB § 1 Rn. 19). Der freiberufliche (freischaffende) Architekt, der sich nur mit typischen Berufsaufgaben des Architekten befaßt, unterhält keinen Gewerbebetrieb (vgl. BGH Urt. v. 22.2.1979 ‒ VII ZR 183/78, BeckRS 1979, 31119803, beck-online). Dass der Beklagte unter dem „Planungsbüro R…“ mehr als nur typische Berufsaufgaben eines Architekten durchgeführt hätte, ist nicht erkennbar.
39
b)
40
Aus der dem Senat feststellbaren objektiv zu bestimmende Zweckrichtung des Rechtsgeschäfts ergibt sich keine überwiegende Zuordnung des Geschäfts zum gewerblichen Bereich des Beklagten.
41
Zweck des Geschäfts war die Sanierung eines im Eigentum des Beklagten stehenden Gebäudes mit dem Ziel der Errichtung von 5 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit.
42
Diese Zielrichtung war zumindest teilweise eindeutig privat. Denn der Beklagte wollte eine Einheit für seine eigenen Wohnzwecke herrichten. Die Errichtung eines Gebäudes zum Zwecke des eigenen Wohngebrauchs ist ein eindeutig privater Zweck. Entsprechend sprach die Klägerin in der Klageschrift auch von einem „privaten Bauvorhaben“ des Beklagten. Dass der Beklagte zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch sein Achitekturbüro in dem Gebäude unterbringen wollte, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Dies ist auch aus den weiteren Umständen nicht eindeutig erkennbar. Insbesondere scheinen Büro- und Wohnadresse des Beklagten bei Vertragsschluss nicht identisch gewesen zu sein. Es findet sich sowohl eine Anschrift „G…straße …“ als auch eine in „O… …“.
43
Auch hinsichtlich der vermieteten Einheiten ist eine gewerbliche Nutzung nicht vorgetragen oder offenkundig. Zunächst ist nichts dafür ersichtlich, dass der Beklagte die weiteren Einheiten veräußern wollte. Vielmehr scheint die Klägerin davon auszugehen, dass das Gebäude insgesamt im Eigentum des Beklagten verblieben ist und er die weiteren Einheiten vermietet. Zweck der Errichtung des Gebäudes war damit ‒ zuweit nicht die eigene Wohnnutzung betroffen war ‒ die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Verwaltung eigenen Vermögens stellt regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit dar, sondern ist dem privaten Bereich zuzuordnen (vgl. BGH NJW 2020, 3786 mwN). Dazu gehören auch der Erwerb, die Verwaltung oder die Weiterveräußerung einer Immobilie. Ein unternehmerischer Grundstückshandel kommt erst dann in Betracht, wenn ein bestimmtes Maß überschritten wird (vgl. BGH NJW 2020, 3786).
44
Die Anzahl der erworbenen Immobilien ist für sich betrachtet nicht maßgeblich. Ein ausgedehntes oder sehr wertvolles Objekt an eine geringe Anzahl von Personen zu vermieten, hält sich daher grundsätzlich im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung. Dagegen spricht die Ausrichtung auf eine Vielzahl gleichartiger Geschäfte für ein professionelles Vorgehen. Ausschlaggebende Kriterien für die Abgrenzung der privaten von der berufsmäßig betriebenen Vermögensverwaltung sind der Umfang, die Komplexität und die Anzahl der damit verbundenen Vorgänge (BGH NZM 2020, 808 = WM 2020, 781 Rn. 13 und NJW 2018, 1812 = WM 2018, 782 Rn. 21 f.). Erfordern diese einen planmäßigen Geschäftsbetrieb ‒ wie etwa die Unterhaltung eines Büros oder einer Organisation ‒ so liegt eine gewerbliche Betätigung vor (vgl. BGH NJW 2020, 3786 mwN; BGH NJW 2020, 808).
45
Zunächst bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Beklagte in einem solchen Umfang Vermietungen vornahm, dass dies einen planmäßigen Geschäftsbetrieb erfordern würde. Dabei ist insbesondere zu sehen, dass sich die Einheiten alle in dem auch von dem Kläger selbst genutzten Gebäudekomplex befinden. Eine Verwaltung von 5 Wohn- und einer Gewerbeeinheit ist auch privat und ohne geschäftsmäßige Organisation möglich.
46
Fraglich ist allenfalls, ob ein (teilweise) gewerbliches Vorgehen deshalb angenommen werden kann, weil der Umbau des Gebäudes als solches einen planmäßigen Geschäftsbetrieb erforderte. So hat der BGH ausgeführt, ab dem Überschreiten einer gewissen Größenordnung von Immobilienkäufen komme ein unternehmerischer Grundstückshandel in Betracht (vgl. BGH aaO). Übertragen auf die Entwicklung oder den Umbau einer Immobilie müsste also eine Größenordnung vorliegen, ab der von einer unternehmerischen Projektentwicklung die Rede wäre. Dies ist aber nicht feststellbar.
47
Zutreffend ist, dass der Beklagte seine Kenntnisse als Architekt einsetzte, um beispielsweise ein Leistungsverzeichnis (Auschreibung) zu erstellen und die Ermittlung des Aufmaßes anzubieten. Auch hat er die Mails zu dem Projekt über seinen beruflich genutzten Account verschickt. Die Nutzung beruflich erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der Einsatz von zum geschäftlichen Bereich gehörenden Sachmitteln kann im Einzelfall durchaus für eine Zuordnung des zu beurteilenden Rechtsgeschäfts zur unternehmerischen Tätigkeit sprechen (vgl. BGH NJW 2018, 150 Rn. 39, beck-online). Andererseits ist ein Rechtsanwalt nicht bereits deshalb immer „Unternehmer“ nur weil er aufgrund seiner Fähigkeiten einen Kauf- oder Mietvertrag entwerfen oder (ohne fremde Hilfe) prüfen kann. Zudem kommt es auf die objektive Zweckrichtung an. Hier ist nicht ersichtlich, dass die von dem Beklagten übernommenen Arbeiten (Leistungsverzeichnis/Aufmaß) einen solchen Umfang gehabt hätten, dass es hierfür eines planmäßigen Geschätsbetriebes bedurft hätten.
48
c)
49
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte in der Vergangenheit vereinzelt oder regelmäßig Immobilienprojekte entwickelt oder die für die Zukunft vorgehabt hätte. Die Klägerin hat dargelgt, dass der Beklagte bislang nur einmal selbst Bauherr gewesen sei und es sich dabei um einen kleinen Pauschalauftrag gehandelt habe. Zudem sei er einmal zusammen mit seinem Ex-Schwiegervater als Bauherr aufgetreten (Bl. 111). Dass der Beklagte das Projekt D… Straße mit seinem früheren Schwiegervater umgesetzt hat, spricht auch nicht dafür, dass er in einem gewerblichen Umfang Immobilienprojekte entwickelt.
50
Überdies scheint die Klägerin selbst davon ausgegangen zu sein, dass der Beklagte hier privat und nicht beruflich handelte. Neben den Ausführungen in der Klageschrift spricht hierfür, dass die Klägerin hinsichtlich der früheren abgewickleten Geschäfts zwischen denen unterschied, in denen der Beklagte als Architekt für einen fremden Bauherrn oder selbst als Bauherr aufgetreten war. Zudem hat sie die Rechnungen an „L… R…“ adressiert und nicht etwa an „Planungsbüro R…“.
51
d)
52
Unerheblich ist, dass der Beklagte in erster Instanz meinte, hinsichtlich der Errichtungskosten des Gebäudes zu einem Vorsteuerabzug berechtigt zu sein. Dies gilt selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass die Ansicht des Beklagten zutreffend war. Denn die Definitionen des Begriffs „Unternehmers“ stimmen im UStG und im BGB nicht überein.
53
Voraussetzung für eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist zunächst eine steuerpflichtige Vermietungsabsicht. Da der Kläger das Gebäude aber auch selbst nutzt, müsste bei Bezug der Werkleistung das Haus insgesamt bereits dem Gegenstand des Unternehmens zugeordnet gewesen sein (vgl. BGH; MwStR 2013, 51 Rn. 56). Ist ein Gegenstand sowohl für den unternehmerischen Bereich als auch für den nichtunternehmerischen privaten Bereich des Unternehmers vorgesehen, wird der Gegenstand nur dann für das Unternehmen bezogen, wenn und soweit der Unternehmer ihn seinem Unternehmen zuordnet (vgl. EuGH v. 8. 3. 2001, C-415/98, Bakcsi, Slg. 2001, I-1831, UR 2001, 149, BFH/NV Beilage 2001, 52, BeckRS 2004, 77131, Leitsatz 1 sowie Rz 25). Zu beachten ist aber, dass der umsatzsteuerliche Unternehmerbegriff iSd § 2 UStG als zentraler Rechtsbegriff des Umsatzsteuerrechts autonom ohne Rückgriff auf andere Definitionen in anderen Rechtsvorschriften ‒ etwa in § 14 BGB ‒ auszulegen ist (vgl. grundlegend: BGH NZM 2020, 808). Nach der Rechtsprechung des BFH umfasst der Begriff auch die private Vermögensverwaltung durch Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (vgl. BFH, NZM 2009, 326). 13 BGB und § 14 BGB stehen in einem anderen Regelungszusammenhang. Für die bürgerlich-rechtlich maßgebliche Abgrenzung von Verbraucher und Unternehmer ist höchstrichterlich seit langem anerkannt, dass die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, soweit sie allein der privaten Vermögensverwaltung dient, die Qualifikation des Vermieters oder Verpächters als Verbraucher nicht hindert (vgl. BGH NZM 2020, 808). Entsprechend hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Vermiter nicht bereits deshalb Unternehmer iSd § 14 BGB ist, weil er hinsichtlich der Vermietung zur Umsatzsteuer optiert (vgl. BGH aaO).
54
III.
55
Die Kostenentscheidung folgt hinsichtlich der 2. Instanz aus § 91 ZPO.
56
Hinsichtlich der 1. Instanz ergibt sich die Kostenentscheidung aus § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat im Rahmen eines fiktiven Streitwertes berücksichtigt, dass die Klägerin auch für die Summe, für die ihr grundsätzlich ein Zinsanspruch zustand, mit ihrer Forderung teilweise unterlegen war, da sie einen zu hohen Zinssatz gefordert hat. Ein Teilunterliegen iSd § 92 ZPO ist zu bejahen, wenn der Zinsantrag hinsichtlich der Höhe des Zinssatzes oder des Zeitpunkts, ab dem eine Geldforderung zu verzinsen ist, (teilweise) abgewiesen wird. Berechnungsmaßstab zur Ermittlung des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens ist in diesem Fall ein fiktiver Gebührenstreitwert unter Einschluss der Zinsforderung (vgl. MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020 Rn. 4, ZPO § 92 Rn. 4). Der Senat folgt dabei nicht der von dem Beklagten errechneten Quotelung. Denn die Vorgehensweise berücksichtigt nicht, dass die verlangten Zinsen teilweise nicht mit einer eigenständigen Begründung, sondern als notwendige Folge der teilweisen Klageabweisung der Hauptforderung versagt wurden.
57
Ein Unterliegen im Zinsausspruch, welches nur das Unterliegen in der Hauptsache widerspiegelt, darf sich nach Ansicht des Senates nicht doppelt auswirken (vgl. ebenso OLG Saarbrücken, Beschluss vom 15.2.2006; 4 W 32/06 = NJW ‒RR 2007, 426; MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020 Rn. 4, ZPO § 92 Rn. 4).
58
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §3 708 Nr. 10, 713 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da § 543 Abs. 2 ZPO nicht einschlägig war.
59
Streitwert 2. Instanz: bis 6.500 €