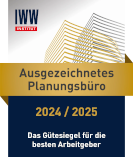24.11.2020 · IWW-Abrufnummer 219101
Landgericht Flensburg: Urteil vom 10.07.2020 – 2 O 285/14
Der Bauherr trägt die Beweislast für die Kausalität einer Pflichtverletzung im Hinblick auf eine Baukostenüberschreitung für einen Schaden. Dabei kann er sich nicht auf Beweiserleichterungen berufen. Insbesondere greift keine Vermutung für einen typischen Geschehensablauf ein. Denn wie sich ein Bauherr verhält, der von seinem Architekten pflichtgemäß über die Höhe der zu erwartenden Baukosten aufgeklärt wird, entzieht sich jeder typisierenden Betrachtung.
Landgericht Flensburg
In dem Rechtsstreit
1) SG , ...
- Klägerin -
2) WG, ...
- Kläger -
Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwälte ...
K B, ...,
- Streithelfer, Beitritt auf Klägerseite -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte ...
gegen
KH, ...
- Beklagte -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte ...
hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Flensburg durch die Richterin am Landgericht ... als Einzelrichterin auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 04.06.2020 für Recht erkannt:
Tenor:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Kläger.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Kläger verlangen von der Beklagten Schadensersatz wegen Baukostenüberschreitung.
Im Jahr 2009 erwogen die Kläger, das Grundstück unter der Adresse ...straße .., F mit dem hierauf befindlichen Wasserturm zu erwerben und den Wasserturm für eine Wohnnutzung umzubauen. Die Beklagte ist Architektin und verfügte bereits damals über Erfahrungen mit der Sanierung und dem Umbau von Wassertürmen. Am 28.4.2009 fand ein erstes Treffen der Parteien in dem eigenen Wasserturm der Beklagten statt. Unter dem 22.5.2009 erstellte die Beklagte eine Kostenschätzung über 671.000,00 € netto (798.490,00 € brutto) (Anlage K 95, Bl. 642 d. A.). Am 23.5.2009 leitete die Beklagte die Kostenschätzung per Email (Anlage K 21, im Anlagenband) an die Kläger weiter und teilte hierzu insbesondere folgendes mit: "Dabei habe ich vom Entwurf bis zu den Kosten alles nach Ihren Vorstellungen aus unseremletzten Treffen eingearbeitet und hoffe, dass Ihnen meine Arbeit zusagt."
Am 7.4.2010 übersandte die Beklagte einen Bauantrag nach § 67 LBO (Bestandteil der Anlage K 23, im Anlagenband) an die Kläger. Hierin veranschlagte sie die Kosten nach StLB, was den Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 entspricht, mit 556.000,00 € netto (661.640,00 € brutto). Dieser Betrag entspricht den entsprechenden Positionen aus der Kostenermittlung vom 22.5.2009.
Mit notariellem Kaufvertrag vom 14.4.2010 (Anlage K 53, Bl. 26 ff. d. A.) erwarben die Kläger das Grundstück mit dem Wasserturm zu einem Preis von 120.000,00 €.
Am 15.4.2010 unterzeichneten die Parteien einen Architektenvertrag (Anlage B4, Bl. 71 ff. d. A.), durch den die Kläger die Beklagte mit der Erbringung von Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 5 beauftragten. In der Anlage zu diesem Architektenvertrag (Anlage B5, Bl. 76 d. A.) wurden als anrechenbare Kosten für die Honorarermittlung angegeben: "ca. 500.000,00 € netto (Kostenschätzung vom 22.5.2009)".
Mit der Erbringung der Leistungsphasen 6-8 beauftragten die Kläger den Streithelfer.
Mit Email vom 23.5.2010 (Anlage K 24, im Anlagenband) übersandte die Beklagte den Klägern zwei Kostenblätter für einen Förderantrag beim Landesamt für Denkmalpflege. Sie teilte hierin mit: "Die Kosten habe ich für den Förderantrag sicherheitshalber etwas höher gesetzt, vielleicht fällt dann auch der gewährte Zuschuss etwas höher aus. Die ganz genauen Kosten werden wie in den nächsten Tagen überechnen, wenn uns die Statik ganz vorliegt." In der Email erläuterte die Beklagte, welche Kostenpositionen sie um welchen Betrag erhöht habe. Die Kostenschätzung für das Bauwerk nach StLB (Bestandteil der Anlage K 25, im Anlagenband) sah hiernach einen Betrag von 628.000,00 € netto (747.320,00 € brutto) vor. Die Kostenschätzung nach DIN 276 (Bestandteil der Anlage K 25, im Anlagenband) sah Kosten von 743.000,00 € netto (884.170,00 € brutto) vor. Mit Email vom 26.5.2010 (Anlage K 26, im Anlagenband) übersandte die Beklagte die Unterlagen an das Landesamt für Denkmalpflege.
Nach Beginn der Ausführung der Arbeiten übersandte die Beklagte dem Kläger mit Email vom 13.9.2010 (Anlage K 28, im Anlagenband) weitere Skizzen. Der Kläger antwortete mit Email vom 14.9.2010 (Anlage K 29, im Anlagenband). Hierin weist der Kläger unter anderem auf Folgendes hin: "Auch sollte alles unternommen werden, dass die von Ihnen vorgenommenen Kostenschätzungen eingehalten werden, da wir danach unsere Bankfinanzierung vorgenommen haben." Die Beklagte antwortet hierauf (Bestandteil der Anlage K 29, im Anlagenband): "Sehr geehrte Fam. G, leider kann ich Ihnen hier nicht wie gewünscht weiterhelfen, da ich in der Haustechnik - Heizung-Sanitär sowie Elektro keinerlei Einfluss bei der Bemusterung und Ausschreibung hatte. Bei den weiteren Gewerken sollten wir vor Versand der LV's genau wie beim Rohbau uns vorher abstimmen. Aber hierzu können wir uns auch noch einmal am 21.09. bei Ihnen unterhalten."
Mit Email 19.10.2010 (Anlage K 30, im Anlagenband) weist der Kläger die Beklagte auf Folgendes hin: "Die Kosten laufen aus dem Ruder, obwohl wir in der Vergangenheit diesen Punkt mehrfach mit Ihnen angesprochen haben und Sie uns immer wieder beruhigt haben. Die Baufinanzierung ist auf Grund ihrer Kostenschätzung erfolgt." Der Kläger verweist sodann auf konkrete Bereiche, in denen Zusatzkosten entstanden seien und fragt: "Wo sollen da evtl. Einsparungen das wieder ausgleichen? Bringen die anderen Gewerke auch noch negative Überraschungen?"
Die Beklagte antwortet mit Email desselben Tages (Anlage K 31, im Anlagenband): "Ich bedaure sehr, dass Ihre Stimmung zu Ihrem Bauvorhaben nicht gut ist. Aberwas da in Beziehung Kosten zur Zeit abläuft ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Ich habe das Gefühl, dass einzelne Mitwirkende [...] Entscheidungen treffen und Auflagen erteilen ohne Kostenverantwortung und ohne Gefühl für das Denkmal. [...] Außerdem habe ich das Gefühl, dass alle einen Rundturmaufschlag von mindestens 10 % raufsetzen. Deshalb sollte mit jeder Firma auch nochmal verhandelt werden."
In der Folgezeit entstanden zunehmend Differenzen zwischen den Parteien. Unter dem 14.3.2011 einigten die Parteien sich auf eine Aufhebung des Architektenvertrags. Die Beklagte übergab den Klägern einen letzten Planungsstand vom 7.2.2011. Mit den Folgeleistungen beauftragten die Kläger den bereits mit den weiteren Leistungsphasen beauftragten Streithelfer, mit dem sie das Bauvorhaben zu Ende führten.
Die Kläger behaupten, ihnen seien Baukosten von über 1.136.000,00 € brutto entstanden. Sie behaupten, die Beklagte hätte richtigerweise in ihren Kostenschätzungen bereits zu einem Betrag in dieser Höhe gelangen müssen. Wäre dies der Fall gewesen, hätten sie das Bauvorhaben nicht durchgeführt und bereits das entsprechende Grundstück nicht erworben. Der Wert des fertiggestellten Wasserturms bleibe mindestens 350.000,00 € hinter den tatsächlich angefallenen Baukosten zurück, so dass ihnen in dieser Höhe ein Schaden entstanden sei.
Die Kläger behaupten, die Parteien hätten einvernehmlich einen Kostenrahmen von 500.000,00 € netto als Orientierung festgelegt. Sie selbst hätten betont, dass dieser Kostenrahmen einzuhalten gewesen sei, was die Beklagte zugesagt habe. Die Kläger behaupten, höhere Kosten seien für sie aus der damaligen finanziellen Perspektive nicht finanzierbar gewesen. Insbesondere hätten die beteiligten Banken eine Finanzierung bei höheren prognostizierten Kosten nicht mitgetragen. Es sei allein dem Zufall zu verdanken, dass sie das Projekt hätten zu Ende führen können und nicht in eine Insolvenz geraten seien. Sie hätten ihre gesamten Ersparnisse in das Projekt gesteckt und ihre Altersvorsorge aufgelöst. Außerdem habe der Geschäftsbetrieb des Klägers unerwartet gute Erträge erzielt.
Die Kläger behaupten, Grundlage der Finanzierungsangebote der Banken sei eine von ihnen erstellte Übersicht zum Finanzierungsbedarf (Anlage K 93, Bl. 639 d. A.) gewesen. Ihre finanziellen Verhältnisse hätten sich damals so dargestellt, wie aus der Vermögensaufstellung vom 17.3.2010 (Anlage K 94, Bl. 640 ff. d. A.) ersichtlich. Auf den Inhalt der vorgenannten Anlagen wird Bezug genommen.
Die Kläger behaupten, im ersten Termin am 28.4.2010 habe eine Planung der Beklagten vorgelegen mit einer Kostenschätzung über 1.207.850,00 € (Bestandteil der Anlage K 101, Bl. 759 d. A.). Sie hätten darauf hingewiesen, dass diese Planung ihre Finanzierungsmöglichkeiten überschreite, woraufhin die Beklagte die Planung geändert habe.
Die Kläger beantragen,
die Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag in Höhe von 350.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte behauptet, ein Kostenrahmen sei nicht vereinbart worden. Vielmehr hätten die Kläger ständig Änderungswünsche gehabt. Der Umbau des Wasserturms habe einen Traum der Kläger dargestellt, von dessen Verwirklichung die Kläger sich durch höhere Kosten nicht hätten abhalten lassen.
Die hiesige Klage ist als Klagerweiterung mit Schriftsatz vom 2.9.2014 in das zwischen denselben Parteien vor dem Landgericht Flensburg zum Az. 2 O 170/13 geführte Verfahren eingeführt worden. Dieser Schriftsatz ist den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 9.9.2014 zugestellt worden. Die Kammer hat den Rechtsstreit 2 O 170/13 durch Urteil beendet und das hiesige Verfahren durch Beschluss vom 24.10.2014 (Bl. 18 f. d. A.) abgetrennt. Die Kammer hat die Parteien persönlich angehört und unter anderem Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen Z1 und Z2. Für das Ergebnis der persönlichen Anhörung und der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4.6.2020 (Bl. 708 ff. d. A.) Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist erfolglos. Sie ist zulässig, aber unbegründet.
A) Die Kläger haben gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung von 350.000,00 € gemäß §§ 280 Abs. 1, 634 Nr. 4, 633, 631 BGB wegen einer Baukostenüberschreitung.
I) Zwischen den Parteien besteht ein Werkvertrag in Form eines Architektenvertrags.
II) Es kann dahinstehen, ob die Beklagte ihre Pflichten aus dem Architektenvertrag verletzt hat, indem sie eine fehlerhafte Kostenschätzung erstellte oder die Kostenvorstellungen der Kläger unzureichend erfragte und bei ihrer Planung daher nicht ausreichend berücksichtigte.
III) Denn die Kläger haben jedenfalls die Kausalität einer solchen Pflichtverletzung für einen etwaigen Schaden nicht bewiesen. Die Kläger behaupten, sie hätten das Bauvorhaben nicht umgesetzt, wenn sie gewusst hätten, dass ihnen Baukosten in Höhe von 1.136.000,00 € brutto entstehen würden. Sie behaupten weiter, zwischen den Baukosten und dem Wert des umgebauten Wasserturms bestehe eine Differenz von mindestens 350.000,00 €. Diese wäre ihnen als Schaden nicht entstanden, wenn ihnen die Höhe der tatsächlichen Kosten bekannt gewesen wäre. Eine Kausalität der Pflichtverletzung für den entstandenen Schaden setzt daher voraus, dass die Kläger bei Prognostizierung von Baukosten in Höhe von 1.136.000,00 € brutto von dem Bauvorhaben Abstand genommen hätten. Die Beweislast für die Kausalität tragen die Kläger. Dabei können sie sich nicht auf Beweiserleichterungen berufen. Insbesondere greift vorliegend keine Vermutung für einen typischen Geschehensablauf ein. Denn wie sich ein Bauherr verhält, der von seinem Architekten pflichtgemäß über die Höhe der zu erwartenden Baukosten aufgeklärt wird, entzieht sich jeder typisierenden Betrachtung (BGH NJW-RR 1997, 850, 852 [BGH 23.01.1997 - VII ZR 171/95]).
Nach Anhörung der Parteien und Durchführung einer Beweisaufnahme ist die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Kläger das Bauvorhaben nicht umgesetzt hätten, wenn ihnen ein Betrag von 1.136.000,00 € brutto als Baukosten im Voraus bekannt gewesen wäre.
1) Die Erforderlichkeit der Einhaltung einer bestimmten Kostengrenze ergibt sich nicht aus der Natur des streitgegenständlichen Bauobjektes. Denn objektiv und unabhängig von der persönlichen Situation der Kläger handelt es sich bei dem Vorhaben, einen ehemaligen Wasserturm zu Wohnzwecken auszubauen, um ein Liebhaberprojekt, dessen Kostenrahmen nahezu ausschließlich von den persönlichen Möglichkeiten und Vorstellungen des Bauherrn abhängt. Es unterscheidet sich damit insbesondere von einem Renditeobjekt, bei dem die Einhaltung eines bestimmten Verhältnisses zwischen Kosten und Nutzen unabdingbare Voraussetzung der geplanten Nutzungsmöglichkeit ist. Die geplante Nutzung als Einfamilienhaus setzt ebenfalls keine Grenzen im Hinblick auf die hinzunehmenden Kosten. Welche Kosten der einzelne für seine eigene Wohnsituation aufzubringen bereit ist, ist nicht objektiv zu ermitteln, sondern hängt von den finanziellen Möglichkeiten und dem Interesse des Betroffenen ab, wobei insbesondere nach oben keine objektive Wertgrenze besteht.
2) Dass die Kläger nicht bereit gewesen wären, Baukosten von 1.136.000,00 € brutto in Kauf zu nehmen, ergibt sich auch nicht aus ihren finanziellen Möglichkeiten. Tatsächlich waren die Kläger in der Lage, diesen Betrag aufzuwenden, ohne auch nur eine Nachfinanzierung zu benötigen. Die Kammer ist davon überzeugt, dass dies auch bereits vor Baubeginn absehbar war. Die Behauptung der Kläger, sie hätten ihre Altersvorsorge auflösen müssen und seien nur knapp einer Insolvenz entgangen, hat sich durch die Beweisaufnahme als unhaltbar erwiesen.
Die von dem Kläger selbst erstellte Vermögensübersicht zeigt, dass die Kläger im Jahr 2010 über erhebliches Vermögen verfügten, das sich aus eigenen Unternehmen, Immobilien, Festgeld, Bankguthaben und Kapitalanlagen zusammensetzte. Neben dem Einfamilienhaus, das sie in die Finanzierung des Wasserturms einbrachten, verfügten sie insbesondere über 7 Eigentumswohnungen, von denen sie nach eigener Darstellung lediglich eine verkauften, um die tatsächlichen Baukosten abzudecken. Die weiteren Mittel für die Baukosten standen den Klägern aus Unternehmensgewinnen zur Verfügung. Außerdem veräußerte der Kläger nach eigener Aussage Autos, die in der Vermögensaufstellung nicht aufgeführt sind. Schon der Umstand, dass der Kläger Autos als nicht so werthaltig ansieht, dass sie in eine Vermögensaufstellung einfließen sollten, zeigt, dass es insgesamt außerordentlich gut um das Vermögen der Kläger bestellt war. Die Darstellung, die Kläger hätten ihre Altersvorsorge auflösen müssen, um das Bauprojekt fertig zu stellen, korrigierte der Kläger in der persönlichen Anhörung dahingehend, dass die weiteren Gewinne ohne die Kostensteigerung zusätzlich für die Altersvorsorge zur Verfügung gestanden hätten. Angesichts des Gesamtvermögens der Kläger kann bei Veräußerung einer Eigentumswohnung von einer Auflösung der Altersvorsorge keine Rede sein.
Auch der Zeuge Z1 bestätigte, dass die Bonität der Kläger außerordentlich gut war. Nach der Darstellung des Zeugen bestand eher ein Wettbewerb der Banken darum, welche Bank die Finanzierung des Projektes übernehmen durfte, als dass die Kläger sich hätten Sorgen machen müssen, ob eine Finanzierung übernommen würde. Die Zeugin Z2 konnte zu den finanziellen Möglichkeiten der Kläger nichts sagen, da sie nicht die Bonitätsprüfung im Hinblick auf das Vorhaben durchgeführt hatte, sondern lediglich mit der Immobilienbewertung befasst war. Dass dann, wenn die Baukosten den späteren Wert der Immobilie erheblich übersteigen, zusätzliches Eigenkapital der Kläger eingebracht werden müsste oder zusätzliche Sicherheiten von den Klägern gestellt werden müssten, ist eine Selbstverständlichkeit. Nach den finanziellen Verhältnissen der Kläger, wie sie sich nach der Beweisaufnahme darstellen, wäre ihnen dies jedoch ohne weiteres möglich gewesen. Wären den Klägern bei Beginn des Projektes Baukosten von 1.136.000,00 € brutto bekannt gewesen, hätten sie von dem Bauprojekt nicht aus finanziellen Gründen Abstand nehmen, sondern lediglich die Finanzierung anders planen müssen.
3) Eine fehlende Kausalität könnte sich daher vorliegend allein aus der fehlenden inneren Bereitschaft der Kläger ergeben, Baukosten von 1.136.000,00 € für den Ausbau des Wasserturms zu Wohnzwecken aufzuwenden. Eine solche innere Bereitschaft ist naturgemäß schwer zu beweisen und dies ist auch den Klägern vorliegend nicht gelungen.
Die Kläger haben in ihrer persönlichen Anhörung geschildert, dass sie sich ein Budget von 1 Million € gesetzt hatten, wobei hierin nicht lediglich die Baukosten, sondern auch der Grundstückskaufpreis und sämtliche Einrichtungen enthalten sein sollten. Der Finanzierungsbedarf, den der Kläger erstellt hatte, sah Gesamtkosten vom 1.100.000,00 € vor. Die Differenz von 100.000,00 € erklärte die Klägerin mit dem einkalkulierten Puffer von 50.000,00 € und der Hoffnung auf weitere Einsparungsmöglichkeiten. Letztlich zeigt diese Darstellung, dass es den Klägern auf 100.000,00 € mehr oder weniger jedenfalls nicht ankam.
Gleiches ergibt sich aus der Kommunikation der Parteien nach einer Email der Beklagten vom 23.5.2010, mit der sie die bisherige Kostenschätzung vom 22.5.2009 von 661.640 € brutto auf 747.320,00 € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 und von 798.490,00 € brutto auf 884.170,00 € brutto für die Kostenermittlung der Gesamtbaukosten erhöhte, wobei sie mitteilte, die Kosten für den Förderantrag beim Landesamt für Denkmalpflege in der Hoffnung auf eine höhere Förderung sicherheitshalber etwas höher angesetzt zu haben. Die Email liest sich so, als sei tatsächlich eher mit niedrigeren Kosten zu rechnen, ohne dass damit feststünde, dass die ursprüngliche Kostenschätzung Bestand haben sollte. Maßgeblich sollte vielmehr eine noch ausstehende Berechnung der Beklagten sein, nach der sie die "ganz genauen Kosten" mitteilen wollte. Tatsächlich erfolgte eine solche Kostenmitteilung nicht, womit die Differenz von immerhin etwa 85.000,00 € im Raum stehen blieb, ohne dass hierzu eine weitere Klärung erfolgte. Wenn diese Differenz für die Kläger erheblich gewesen wäre, hätte eine Nachfrage zu den "ganz genauen Kosten" mehr als nahegelegen. Auch die Kläger kamen auf die Frage nach den "ganz genauen Kosten" jedoch nicht zurück.
Die Kostenschätzung für die Außenanlagen deutet ebenfalls darauf hin, dass es den Klägern auf Beträge unter 100.000,00 € nicht ankam. Denn die Beklagte setzte in ihrer Kostenermittlung vom 22.5.2009 für Außenanlagen einen Betrag von 11.900,00 € brutto an. Der Kläger hingegen nahm in seinen Finanzierungsbedarf für "Gartengestaltung/Terrassen/Pflasterung" einen Betrag von 60.000,00 € auf. Eine Notwendigkeit, diese Differenz in den Vorstellungen mit der Beklagten zu besprechen, sahen die Kläger nicht. Unabhängig davon, ob die Beklagte die Planung der Außenanlagen tatsächlich nicht übernehmen sollte, wäre zu erwarten gewesen, dass die Kläger dann, wenn sie einen in der Kostenermittlung angesetzten Betrag für zu niedrig halten, die Beklagte hierauf hinweisen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Kostenermittlung eine besondere Bedeutung im Hinblick auf eine Kostengrenze hätte zukommen sollen.
Der Vortrag der Kläger zu einer Kostengrenze stellte sich im Verlauf des Prozesses darüber hinaus als höchst widersprüchlich dar. Ursprünglich behaupteten sie die Vereinbarung einer Kostengrenze von 500.000,00 € netto (595.00,00 € brutto). Dieser Betrag entspricht der in der Honorarermittlung zum Architektenvertrag angegebenen Summe. Im Rahmen der persönlichen Anhörung stellte sich als unstreitig heraus, dass dieser Betrag lediglich zur Reduzierung des Architektenhonorars niedrig angesetzt wurde und von vornherein eine Kostenschätzung nur für die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in Höhe von 556.000 € netto vorlag. Für die Gesamtbaukosten hingegen sah die Kostenermittlung der Beklagten vom 22.5.2009 Kosten von 798.490 € brutto vor. Dementsprechend findet sich auch in dem von dem Kläger erstellten Finanzierungsbedarf für die Baukosten ein Betrag von 800.000,00 €. Im Mai 2010 folgte dann die Kommunikation hinsichtlich der für den Förderantrag höher angesetzten Kosten von insgesamt 884.170,00 € brutto. Die als "feste Summe" für das Gesamtprojekt geschilderte Summe von 1 Million € haben die Kläger erstmals in ihrer persönlichen Anhörung am 4.6.2020, also fast 6 Jahre nach Klagerhebung im Hinblick auf die Baukostenüberschreitung, in den Prozess eingebracht. Angesichts dieser, um weit mehr als 100.000,00 € auseinanderliegenden Behauptungen der Kläger zu einer vereinbarten oder zumindest vorgestellten Kostengrenze fällt es der Kammer schwer, zu beurteilen, ob es tatsächlich einen Betrag gab, den die Kläger nicht zu überschreiten bereit waren und falls ja, welcher dieses gewesen sein könnte.
Insbesondere sieht sich die Kammer nicht in der Lage, festzustellen, ob mit dem Betrag von 1.207.850,00 € eine für die Kläger akzeptable Kostengrenze überschritten wurde. Dieser Betrag findet sich in einer Kostenschätzung der Beklagten, die die Kläger erstmals mit dem in der Verhandlung vom 4.6.2020 nachgelassenen Schriftsatz vorlegen, zu dem die Beklagte noch keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen wesentlich anderen Ausbau des Wasserturms mit mehreren Wohnungen. Festzustellen ist lediglich, dass diese Art der Planung mit der verbundenen Kostenschätzung nicht zur Ausführung kam. Dass Grund hierfür eine Überschreitung der für die Kläger akzeptablen Kosten war und dass die Kläger der Beklagten dies im ersten Termin am 28.4.2009 mitgeteilt hätten, stellt eine bloße Behauptung der Kläger dar. Dieser steht die Aussage der Beklagten entgegen, wonach im ersten Termin am 28.4.2009 über Kosten gar nicht gesprochen worden sei und es sich bei den damals vorliegenden Unterlagen lediglich um eine Machbarkeitsstudie gehandelt habe - ein Begriff, der sich in den klägerseits vorgelegten Unterlagen wiederfindet. Die Kammer vermag insoweit nicht einzuschätzen, wessen Angaben der Wahrheit entsprechen. Grundsätzlich haben beide Parteien in ihrer persönlichen Anhörung nicht den Eindruck erweckt, bewusst unzutreffend vorzutragen. Widersprüche im Vortrag der Kläger ergeben sich im Wesentlichen im Hinblick auf den schriftsätzlichen Vortrag, auf dessen Richtigkeit die Kläger grundsätzlich allerdings ebenfalls hinwirken sollten. Die Beklagte wirkte in jeder mündlichen Verhandlung, insbesondere auch schon während des abgetrennten Verfahrensteils und bei der - nach dem weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr erheblichen - Sachverständigenanhörung in besonderem Maße sachorientiert. Sie erweckte an keiner Stelle den Eindruck, den Sachverhalt zu ihren Gunsten verändern zu wollen, sondern stets den Eindruck einer gewissenhaften Befassung mit der Sache. Zu bemerken ist, dass die Beklagte nie behauptete, dass die Kläger geäußert hätten, der Preis spiele für sie keine wesentliche Rolle - ein Vortrag, der bei einer weniger an der Wahrheit als am eigenen Vorteil orientierten Partei naheliegender gewesen wäre, als die Behauptung, es sei über die Kostenvorstellungen der Kläger nicht gesprochen worden, womit die Beklagte sich gleichzeitig dem Vorwurf des nicht ausreichenden Erfragens eben dieser Vorstellungen aussetzt. Andererseits spricht der Wortlaut der Email vom 23.5.2009 durchaus dafür, dass Kostenvorstellungen der Kläger zuvor erörtert wurden. Ob dies aber im Zusammenhang mit einer Obergrenze des von den Klägern für das Projekt angesetzten Budgets der Fall war, vermag die Kammer ebenso wenig zu sagen wie, ob es für die Kläger eine solche Obergrenze überhaupt gab.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Kläger zuvor in einem Einfamilienhaus wohnten, das nach ihrer Darstellung einen Wert von weniger als 400.000,00 € hatte. Denn dies schließt nicht aus, dass sie bereit gewesen wären, einen wesentlich höheren Betrag für die Baukosten des Wasserturms auszugeben. Die Kläger selbst schilderten, dass nach ihrer Vorstellung in dem Wasserturm eine Luxuswohnung entstehen sollte. Eine Luxuswohnung in einem Wasserturm ist mit einem Einfamilienhaus - auch gehobenen Standards - nur in Grenzen vergleichbar, sodass sich keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen, welche Kosten die Kläger auf sich zu nehmen bereit waren. Die Änderung der Wohnsituation war in jedem Fall mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden - wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein durften, ergibt sich aus der ursprünglichen Wohnsituation nicht.
Es lässt sich auch nichts zu Gunsten der Kläger daraus herleiten, dass sie im Verlauf des Bauvorhabens auf die Einhaltung der prognostizierten Kosten drängten. Die Kammer zweifelt nicht daran, dass die Kläger sich an der Kostenschätzung vom 22.5.2009 orientierten und dass diese auch Grundlage der geplanten Finanzierung war. Es ist daher nachvollziehbar, wenn sie deren Einhaltung erwarteten. Sofern die Kosten tatsächlich ohne Beauftragung von Zusatzleistungen um mehrere 100.000,00 € über den prognostizierten Kosten gelegen haben sollten, ist verständlich, wenn die Kläger hierauf ungehalten reagieren. Dies gilt insbesondere für den Kläger, der als Geschäftsmann nach Einschätzung der Kammer daran gewöhnt war, Kosten und Gewinne zutreffend zu kalkulieren und von dem daher anzunehmen ist, dass er dies auch von der Beklagten erwartete. Der Ärger der Kläger über die Nichteinhaltung der prognostizierten Kosten sagt gleichwohl nichts darüber aus, wie sie sich verhalten hätten, wenn ihnen die höheren Kosten von vornherein bekannt gewesen wären. Dies zeigt beispielhaft die Reaktion des Zeugen Z1, der in nachträglich sich herausstellenden Mehrkosten von 400.000,00 € sowohl für den Bauherrn als auch für die finanzierende Bank ein erhebliches Problem sah, während er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass die Kläger bei ursprünglich entsprechend höheren Kosten einen solchen Betrag nicht hätten finanzieren können. Fraglich wäre, ob sie dies gewollt hätten, was sich im Nachhinein nur schwer beantworten lässt.
Dafür, dass die Kläger bereit gewesen, Baukosten von 1.136.000,00 € in Kauf zu nehmen, spricht insbesondere die Begeisterung der Kläger für das Projekt. Der Umbau des Wasserturms zu Wohnzwecken ist nicht alltäglich, sondern entsprang der eigenen, kreativen Idee der Kläger. Ein solches Projekt ist ohne eine besondere Begeisterung hierfür praktisch nicht denkbar. Nicht nur die Beklagte schilderte, dass die Kläger für das Projekt "brannten", sondern auch die Zeugin Z2 erinnerte sich daran, dass bei den Klägern "ein ganz großer Idealismus" vorhanden gewesen sei. Nach Ansicht der Kammer hätte diese Begeisterung in Kombination mit den finanziellen Möglichkeiten zumindest dazu führen können, dass die Kläger auch ein größeres Budget in Kauf genommen hätten. Die Zeugin Z2 hat hierzu insbesondere nichts Gegenteiliges geäußert, sondern erklärt, dass sie nichts darüber sagen könne, was die Kläger auszugeben bereit gewesen wären.
Insgesamt ist damit aus Sicht der Kammer zwar denkbar, dass die Kläger sich selbst das Budget von 1 Million € vorgestellt hatten. Bei einem Geschäftsmann wie dem Kläger erscheint es durchaus plausibel, dass dieser trotz seines großen Vermögens auch bei privaten Ausgaben bestimmte Kostenvorstellungen entwickelt. Ebenso deutet die von dem Kläger erstellte Vermögensübersicht nicht darauf hin, dass die Kläger erhebliche Risiken bei der Anlage ihres Vermögens eingingen. Es scheint daher nicht fernliegend, dass die Kläger auch für das eigene Wohnprojekt einen Kostenrahmen im Kopf hatten, dessen Einhaltung sie beabsichtigten. Wie sich die Kläger aber verhalten hätten, wenn sie von vornherein gewusst hätten, dass dieser Kostenrahmen nicht umsetzbar ist, vermag die Kammer nicht zu sagen. Sicherlich ist eine Möglichkeit, dass die Kläger auf die Umsetzung des Projektes verzichtet hätten. Aus Sicht der Kammer besteht aber ebenso die Möglichkeit, dass sie lediglich die Finanzierung von vornherein angepasst und das Projekt genauso durchgeführt hätten, wie sie es tatsächlich durchgeführt haben.
Eine weitere Aufklärung durch Vernehmung des Zeugen Z3 hält die Kammer für entbehrlich. Die Kläger behaupten, sie hätten gegenüber dem Verkäufer des Grundstücks ihre Vorstellungen zu den Gesamtkosten des Bauprojektes geäußert und ihm mitgeteilt, dass sie höhere Kosten nicht finanzieren könnten. Es kann dahinstehen, ob die Kläger entsprechende Äußerungen gegenüber dem Zeugen Z3 getätigt haben. Jedenfalls würden diese nichts darüber aussagen, welchen Betrag die Kläger tatsächlich zu investieren bereit und in der Lage waren. Die Angabe eines niedrigen Betrages und die - nach der weiteren Beweisaufnahme nachweislich unzutreffende - Behauptung gegenüber dem Verkäufer, höhere Kosten nicht finanzieren zu können, könnte allein dem Zweck gedient haben, den Kaufpreis für das Grundstück zu reduzieren.
B) Mangels Hauptanspruchs besteht auch kein Zinsanspruch.
C) Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1, 2 ZPO.
Urteil vom 10.07.2020
In dem Rechtsstreit
1) SG , ...
- Klägerin -
2) WG, ...
- Kläger -
Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwälte ...
K B, ...,
- Streithelfer, Beitritt auf Klägerseite -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte ...
gegen
KH, ...
- Beklagte -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte ...
hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Flensburg durch die Richterin am Landgericht ... als Einzelrichterin auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 04.06.2020 für Recht erkannt:
Tenor:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Kläger.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Kläger verlangen von der Beklagten Schadensersatz wegen Baukostenüberschreitung.
Im Jahr 2009 erwogen die Kläger, das Grundstück unter der Adresse ...straße .., F mit dem hierauf befindlichen Wasserturm zu erwerben und den Wasserturm für eine Wohnnutzung umzubauen. Die Beklagte ist Architektin und verfügte bereits damals über Erfahrungen mit der Sanierung und dem Umbau von Wassertürmen. Am 28.4.2009 fand ein erstes Treffen der Parteien in dem eigenen Wasserturm der Beklagten statt. Unter dem 22.5.2009 erstellte die Beklagte eine Kostenschätzung über 671.000,00 € netto (798.490,00 € brutto) (Anlage K 95, Bl. 642 d. A.). Am 23.5.2009 leitete die Beklagte die Kostenschätzung per Email (Anlage K 21, im Anlagenband) an die Kläger weiter und teilte hierzu insbesondere folgendes mit: "Dabei habe ich vom Entwurf bis zu den Kosten alles nach Ihren Vorstellungen aus unseremletzten Treffen eingearbeitet und hoffe, dass Ihnen meine Arbeit zusagt."
Am 7.4.2010 übersandte die Beklagte einen Bauantrag nach § 67 LBO (Bestandteil der Anlage K 23, im Anlagenband) an die Kläger. Hierin veranschlagte sie die Kosten nach StLB, was den Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 entspricht, mit 556.000,00 € netto (661.640,00 € brutto). Dieser Betrag entspricht den entsprechenden Positionen aus der Kostenermittlung vom 22.5.2009.
Mit notariellem Kaufvertrag vom 14.4.2010 (Anlage K 53, Bl. 26 ff. d. A.) erwarben die Kläger das Grundstück mit dem Wasserturm zu einem Preis von 120.000,00 €.
Am 15.4.2010 unterzeichneten die Parteien einen Architektenvertrag (Anlage B4, Bl. 71 ff. d. A.), durch den die Kläger die Beklagte mit der Erbringung von Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 5 beauftragten. In der Anlage zu diesem Architektenvertrag (Anlage B5, Bl. 76 d. A.) wurden als anrechenbare Kosten für die Honorarermittlung angegeben: "ca. 500.000,00 € netto (Kostenschätzung vom 22.5.2009)".
Mit der Erbringung der Leistungsphasen 6-8 beauftragten die Kläger den Streithelfer.
Mit Email vom 23.5.2010 (Anlage K 24, im Anlagenband) übersandte die Beklagte den Klägern zwei Kostenblätter für einen Förderantrag beim Landesamt für Denkmalpflege. Sie teilte hierin mit: "Die Kosten habe ich für den Förderantrag sicherheitshalber etwas höher gesetzt, vielleicht fällt dann auch der gewährte Zuschuss etwas höher aus. Die ganz genauen Kosten werden wie in den nächsten Tagen überechnen, wenn uns die Statik ganz vorliegt." In der Email erläuterte die Beklagte, welche Kostenpositionen sie um welchen Betrag erhöht habe. Die Kostenschätzung für das Bauwerk nach StLB (Bestandteil der Anlage K 25, im Anlagenband) sah hiernach einen Betrag von 628.000,00 € netto (747.320,00 € brutto) vor. Die Kostenschätzung nach DIN 276 (Bestandteil der Anlage K 25, im Anlagenband) sah Kosten von 743.000,00 € netto (884.170,00 € brutto) vor. Mit Email vom 26.5.2010 (Anlage K 26, im Anlagenband) übersandte die Beklagte die Unterlagen an das Landesamt für Denkmalpflege.
Nach Beginn der Ausführung der Arbeiten übersandte die Beklagte dem Kläger mit Email vom 13.9.2010 (Anlage K 28, im Anlagenband) weitere Skizzen. Der Kläger antwortete mit Email vom 14.9.2010 (Anlage K 29, im Anlagenband). Hierin weist der Kläger unter anderem auf Folgendes hin: "Auch sollte alles unternommen werden, dass die von Ihnen vorgenommenen Kostenschätzungen eingehalten werden, da wir danach unsere Bankfinanzierung vorgenommen haben." Die Beklagte antwortet hierauf (Bestandteil der Anlage K 29, im Anlagenband): "Sehr geehrte Fam. G, leider kann ich Ihnen hier nicht wie gewünscht weiterhelfen, da ich in der Haustechnik - Heizung-Sanitär sowie Elektro keinerlei Einfluss bei der Bemusterung und Ausschreibung hatte. Bei den weiteren Gewerken sollten wir vor Versand der LV's genau wie beim Rohbau uns vorher abstimmen. Aber hierzu können wir uns auch noch einmal am 21.09. bei Ihnen unterhalten."
Mit Email 19.10.2010 (Anlage K 30, im Anlagenband) weist der Kläger die Beklagte auf Folgendes hin: "Die Kosten laufen aus dem Ruder, obwohl wir in der Vergangenheit diesen Punkt mehrfach mit Ihnen angesprochen haben und Sie uns immer wieder beruhigt haben. Die Baufinanzierung ist auf Grund ihrer Kostenschätzung erfolgt." Der Kläger verweist sodann auf konkrete Bereiche, in denen Zusatzkosten entstanden seien und fragt: "Wo sollen da evtl. Einsparungen das wieder ausgleichen? Bringen die anderen Gewerke auch noch negative Überraschungen?"
Die Beklagte antwortet mit Email desselben Tages (Anlage K 31, im Anlagenband): "Ich bedaure sehr, dass Ihre Stimmung zu Ihrem Bauvorhaben nicht gut ist. Aberwas da in Beziehung Kosten zur Zeit abläuft ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Ich habe das Gefühl, dass einzelne Mitwirkende [...] Entscheidungen treffen und Auflagen erteilen ohne Kostenverantwortung und ohne Gefühl für das Denkmal. [...] Außerdem habe ich das Gefühl, dass alle einen Rundturmaufschlag von mindestens 10 % raufsetzen. Deshalb sollte mit jeder Firma auch nochmal verhandelt werden."
In der Folgezeit entstanden zunehmend Differenzen zwischen den Parteien. Unter dem 14.3.2011 einigten die Parteien sich auf eine Aufhebung des Architektenvertrags. Die Beklagte übergab den Klägern einen letzten Planungsstand vom 7.2.2011. Mit den Folgeleistungen beauftragten die Kläger den bereits mit den weiteren Leistungsphasen beauftragten Streithelfer, mit dem sie das Bauvorhaben zu Ende führten.
Die Kläger behaupten, ihnen seien Baukosten von über 1.136.000,00 € brutto entstanden. Sie behaupten, die Beklagte hätte richtigerweise in ihren Kostenschätzungen bereits zu einem Betrag in dieser Höhe gelangen müssen. Wäre dies der Fall gewesen, hätten sie das Bauvorhaben nicht durchgeführt und bereits das entsprechende Grundstück nicht erworben. Der Wert des fertiggestellten Wasserturms bleibe mindestens 350.000,00 € hinter den tatsächlich angefallenen Baukosten zurück, so dass ihnen in dieser Höhe ein Schaden entstanden sei.
Die Kläger behaupten, die Parteien hätten einvernehmlich einen Kostenrahmen von 500.000,00 € netto als Orientierung festgelegt. Sie selbst hätten betont, dass dieser Kostenrahmen einzuhalten gewesen sei, was die Beklagte zugesagt habe. Die Kläger behaupten, höhere Kosten seien für sie aus der damaligen finanziellen Perspektive nicht finanzierbar gewesen. Insbesondere hätten die beteiligten Banken eine Finanzierung bei höheren prognostizierten Kosten nicht mitgetragen. Es sei allein dem Zufall zu verdanken, dass sie das Projekt hätten zu Ende führen können und nicht in eine Insolvenz geraten seien. Sie hätten ihre gesamten Ersparnisse in das Projekt gesteckt und ihre Altersvorsorge aufgelöst. Außerdem habe der Geschäftsbetrieb des Klägers unerwartet gute Erträge erzielt.
Die Kläger behaupten, Grundlage der Finanzierungsangebote der Banken sei eine von ihnen erstellte Übersicht zum Finanzierungsbedarf (Anlage K 93, Bl. 639 d. A.) gewesen. Ihre finanziellen Verhältnisse hätten sich damals so dargestellt, wie aus der Vermögensaufstellung vom 17.3.2010 (Anlage K 94, Bl. 640 ff. d. A.) ersichtlich. Auf den Inhalt der vorgenannten Anlagen wird Bezug genommen.
Die Kläger behaupten, im ersten Termin am 28.4.2010 habe eine Planung der Beklagten vorgelegen mit einer Kostenschätzung über 1.207.850,00 € (Bestandteil der Anlage K 101, Bl. 759 d. A.). Sie hätten darauf hingewiesen, dass diese Planung ihre Finanzierungsmöglichkeiten überschreite, woraufhin die Beklagte die Planung geändert habe.
Die Kläger beantragen,
die Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag in Höhe von 350.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte behauptet, ein Kostenrahmen sei nicht vereinbart worden. Vielmehr hätten die Kläger ständig Änderungswünsche gehabt. Der Umbau des Wasserturms habe einen Traum der Kläger dargestellt, von dessen Verwirklichung die Kläger sich durch höhere Kosten nicht hätten abhalten lassen.
Die hiesige Klage ist als Klagerweiterung mit Schriftsatz vom 2.9.2014 in das zwischen denselben Parteien vor dem Landgericht Flensburg zum Az. 2 O 170/13 geführte Verfahren eingeführt worden. Dieser Schriftsatz ist den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 9.9.2014 zugestellt worden. Die Kammer hat den Rechtsstreit 2 O 170/13 durch Urteil beendet und das hiesige Verfahren durch Beschluss vom 24.10.2014 (Bl. 18 f. d. A.) abgetrennt. Die Kammer hat die Parteien persönlich angehört und unter anderem Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen Z1 und Z2. Für das Ergebnis der persönlichen Anhörung und der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4.6.2020 (Bl. 708 ff. d. A.) Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist erfolglos. Sie ist zulässig, aber unbegründet.
A) Die Kläger haben gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung von 350.000,00 € gemäß §§ 280 Abs. 1, 634 Nr. 4, 633, 631 BGB wegen einer Baukostenüberschreitung.
I) Zwischen den Parteien besteht ein Werkvertrag in Form eines Architektenvertrags.
II) Es kann dahinstehen, ob die Beklagte ihre Pflichten aus dem Architektenvertrag verletzt hat, indem sie eine fehlerhafte Kostenschätzung erstellte oder die Kostenvorstellungen der Kläger unzureichend erfragte und bei ihrer Planung daher nicht ausreichend berücksichtigte.
III) Denn die Kläger haben jedenfalls die Kausalität einer solchen Pflichtverletzung für einen etwaigen Schaden nicht bewiesen. Die Kläger behaupten, sie hätten das Bauvorhaben nicht umgesetzt, wenn sie gewusst hätten, dass ihnen Baukosten in Höhe von 1.136.000,00 € brutto entstehen würden. Sie behaupten weiter, zwischen den Baukosten und dem Wert des umgebauten Wasserturms bestehe eine Differenz von mindestens 350.000,00 €. Diese wäre ihnen als Schaden nicht entstanden, wenn ihnen die Höhe der tatsächlichen Kosten bekannt gewesen wäre. Eine Kausalität der Pflichtverletzung für den entstandenen Schaden setzt daher voraus, dass die Kläger bei Prognostizierung von Baukosten in Höhe von 1.136.000,00 € brutto von dem Bauvorhaben Abstand genommen hätten. Die Beweislast für die Kausalität tragen die Kläger. Dabei können sie sich nicht auf Beweiserleichterungen berufen. Insbesondere greift vorliegend keine Vermutung für einen typischen Geschehensablauf ein. Denn wie sich ein Bauherr verhält, der von seinem Architekten pflichtgemäß über die Höhe der zu erwartenden Baukosten aufgeklärt wird, entzieht sich jeder typisierenden Betrachtung (BGH NJW-RR 1997, 850, 852 [BGH 23.01.1997 - VII ZR 171/95]).
Nach Anhörung der Parteien und Durchführung einer Beweisaufnahme ist die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Kläger das Bauvorhaben nicht umgesetzt hätten, wenn ihnen ein Betrag von 1.136.000,00 € brutto als Baukosten im Voraus bekannt gewesen wäre.
1) Die Erforderlichkeit der Einhaltung einer bestimmten Kostengrenze ergibt sich nicht aus der Natur des streitgegenständlichen Bauobjektes. Denn objektiv und unabhängig von der persönlichen Situation der Kläger handelt es sich bei dem Vorhaben, einen ehemaligen Wasserturm zu Wohnzwecken auszubauen, um ein Liebhaberprojekt, dessen Kostenrahmen nahezu ausschließlich von den persönlichen Möglichkeiten und Vorstellungen des Bauherrn abhängt. Es unterscheidet sich damit insbesondere von einem Renditeobjekt, bei dem die Einhaltung eines bestimmten Verhältnisses zwischen Kosten und Nutzen unabdingbare Voraussetzung der geplanten Nutzungsmöglichkeit ist. Die geplante Nutzung als Einfamilienhaus setzt ebenfalls keine Grenzen im Hinblick auf die hinzunehmenden Kosten. Welche Kosten der einzelne für seine eigene Wohnsituation aufzubringen bereit ist, ist nicht objektiv zu ermitteln, sondern hängt von den finanziellen Möglichkeiten und dem Interesse des Betroffenen ab, wobei insbesondere nach oben keine objektive Wertgrenze besteht.
2) Dass die Kläger nicht bereit gewesen wären, Baukosten von 1.136.000,00 € brutto in Kauf zu nehmen, ergibt sich auch nicht aus ihren finanziellen Möglichkeiten. Tatsächlich waren die Kläger in der Lage, diesen Betrag aufzuwenden, ohne auch nur eine Nachfinanzierung zu benötigen. Die Kammer ist davon überzeugt, dass dies auch bereits vor Baubeginn absehbar war. Die Behauptung der Kläger, sie hätten ihre Altersvorsorge auflösen müssen und seien nur knapp einer Insolvenz entgangen, hat sich durch die Beweisaufnahme als unhaltbar erwiesen.
Die von dem Kläger selbst erstellte Vermögensübersicht zeigt, dass die Kläger im Jahr 2010 über erhebliches Vermögen verfügten, das sich aus eigenen Unternehmen, Immobilien, Festgeld, Bankguthaben und Kapitalanlagen zusammensetzte. Neben dem Einfamilienhaus, das sie in die Finanzierung des Wasserturms einbrachten, verfügten sie insbesondere über 7 Eigentumswohnungen, von denen sie nach eigener Darstellung lediglich eine verkauften, um die tatsächlichen Baukosten abzudecken. Die weiteren Mittel für die Baukosten standen den Klägern aus Unternehmensgewinnen zur Verfügung. Außerdem veräußerte der Kläger nach eigener Aussage Autos, die in der Vermögensaufstellung nicht aufgeführt sind. Schon der Umstand, dass der Kläger Autos als nicht so werthaltig ansieht, dass sie in eine Vermögensaufstellung einfließen sollten, zeigt, dass es insgesamt außerordentlich gut um das Vermögen der Kläger bestellt war. Die Darstellung, die Kläger hätten ihre Altersvorsorge auflösen müssen, um das Bauprojekt fertig zu stellen, korrigierte der Kläger in der persönlichen Anhörung dahingehend, dass die weiteren Gewinne ohne die Kostensteigerung zusätzlich für die Altersvorsorge zur Verfügung gestanden hätten. Angesichts des Gesamtvermögens der Kläger kann bei Veräußerung einer Eigentumswohnung von einer Auflösung der Altersvorsorge keine Rede sein.
Auch der Zeuge Z1 bestätigte, dass die Bonität der Kläger außerordentlich gut war. Nach der Darstellung des Zeugen bestand eher ein Wettbewerb der Banken darum, welche Bank die Finanzierung des Projektes übernehmen durfte, als dass die Kläger sich hätten Sorgen machen müssen, ob eine Finanzierung übernommen würde. Die Zeugin Z2 konnte zu den finanziellen Möglichkeiten der Kläger nichts sagen, da sie nicht die Bonitätsprüfung im Hinblick auf das Vorhaben durchgeführt hatte, sondern lediglich mit der Immobilienbewertung befasst war. Dass dann, wenn die Baukosten den späteren Wert der Immobilie erheblich übersteigen, zusätzliches Eigenkapital der Kläger eingebracht werden müsste oder zusätzliche Sicherheiten von den Klägern gestellt werden müssten, ist eine Selbstverständlichkeit. Nach den finanziellen Verhältnissen der Kläger, wie sie sich nach der Beweisaufnahme darstellen, wäre ihnen dies jedoch ohne weiteres möglich gewesen. Wären den Klägern bei Beginn des Projektes Baukosten von 1.136.000,00 € brutto bekannt gewesen, hätten sie von dem Bauprojekt nicht aus finanziellen Gründen Abstand nehmen, sondern lediglich die Finanzierung anders planen müssen.
3) Eine fehlende Kausalität könnte sich daher vorliegend allein aus der fehlenden inneren Bereitschaft der Kläger ergeben, Baukosten von 1.136.000,00 € für den Ausbau des Wasserturms zu Wohnzwecken aufzuwenden. Eine solche innere Bereitschaft ist naturgemäß schwer zu beweisen und dies ist auch den Klägern vorliegend nicht gelungen.
Die Kläger haben in ihrer persönlichen Anhörung geschildert, dass sie sich ein Budget von 1 Million € gesetzt hatten, wobei hierin nicht lediglich die Baukosten, sondern auch der Grundstückskaufpreis und sämtliche Einrichtungen enthalten sein sollten. Der Finanzierungsbedarf, den der Kläger erstellt hatte, sah Gesamtkosten vom 1.100.000,00 € vor. Die Differenz von 100.000,00 € erklärte die Klägerin mit dem einkalkulierten Puffer von 50.000,00 € und der Hoffnung auf weitere Einsparungsmöglichkeiten. Letztlich zeigt diese Darstellung, dass es den Klägern auf 100.000,00 € mehr oder weniger jedenfalls nicht ankam.
Gleiches ergibt sich aus der Kommunikation der Parteien nach einer Email der Beklagten vom 23.5.2010, mit der sie die bisherige Kostenschätzung vom 22.5.2009 von 661.640 € brutto auf 747.320,00 € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 und von 798.490,00 € brutto auf 884.170,00 € brutto für die Kostenermittlung der Gesamtbaukosten erhöhte, wobei sie mitteilte, die Kosten für den Förderantrag beim Landesamt für Denkmalpflege in der Hoffnung auf eine höhere Förderung sicherheitshalber etwas höher angesetzt zu haben. Die Email liest sich so, als sei tatsächlich eher mit niedrigeren Kosten zu rechnen, ohne dass damit feststünde, dass die ursprüngliche Kostenschätzung Bestand haben sollte. Maßgeblich sollte vielmehr eine noch ausstehende Berechnung der Beklagten sein, nach der sie die "ganz genauen Kosten" mitteilen wollte. Tatsächlich erfolgte eine solche Kostenmitteilung nicht, womit die Differenz von immerhin etwa 85.000,00 € im Raum stehen blieb, ohne dass hierzu eine weitere Klärung erfolgte. Wenn diese Differenz für die Kläger erheblich gewesen wäre, hätte eine Nachfrage zu den "ganz genauen Kosten" mehr als nahegelegen. Auch die Kläger kamen auf die Frage nach den "ganz genauen Kosten" jedoch nicht zurück.
Die Kostenschätzung für die Außenanlagen deutet ebenfalls darauf hin, dass es den Klägern auf Beträge unter 100.000,00 € nicht ankam. Denn die Beklagte setzte in ihrer Kostenermittlung vom 22.5.2009 für Außenanlagen einen Betrag von 11.900,00 € brutto an. Der Kläger hingegen nahm in seinen Finanzierungsbedarf für "Gartengestaltung/Terrassen/Pflasterung" einen Betrag von 60.000,00 € auf. Eine Notwendigkeit, diese Differenz in den Vorstellungen mit der Beklagten zu besprechen, sahen die Kläger nicht. Unabhängig davon, ob die Beklagte die Planung der Außenanlagen tatsächlich nicht übernehmen sollte, wäre zu erwarten gewesen, dass die Kläger dann, wenn sie einen in der Kostenermittlung angesetzten Betrag für zu niedrig halten, die Beklagte hierauf hinweisen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Kostenermittlung eine besondere Bedeutung im Hinblick auf eine Kostengrenze hätte zukommen sollen.
Der Vortrag der Kläger zu einer Kostengrenze stellte sich im Verlauf des Prozesses darüber hinaus als höchst widersprüchlich dar. Ursprünglich behaupteten sie die Vereinbarung einer Kostengrenze von 500.000,00 € netto (595.00,00 € brutto). Dieser Betrag entspricht der in der Honorarermittlung zum Architektenvertrag angegebenen Summe. Im Rahmen der persönlichen Anhörung stellte sich als unstreitig heraus, dass dieser Betrag lediglich zur Reduzierung des Architektenhonorars niedrig angesetzt wurde und von vornherein eine Kostenschätzung nur für die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in Höhe von 556.000 € netto vorlag. Für die Gesamtbaukosten hingegen sah die Kostenermittlung der Beklagten vom 22.5.2009 Kosten von 798.490 € brutto vor. Dementsprechend findet sich auch in dem von dem Kläger erstellten Finanzierungsbedarf für die Baukosten ein Betrag von 800.000,00 €. Im Mai 2010 folgte dann die Kommunikation hinsichtlich der für den Förderantrag höher angesetzten Kosten von insgesamt 884.170,00 € brutto. Die als "feste Summe" für das Gesamtprojekt geschilderte Summe von 1 Million € haben die Kläger erstmals in ihrer persönlichen Anhörung am 4.6.2020, also fast 6 Jahre nach Klagerhebung im Hinblick auf die Baukostenüberschreitung, in den Prozess eingebracht. Angesichts dieser, um weit mehr als 100.000,00 € auseinanderliegenden Behauptungen der Kläger zu einer vereinbarten oder zumindest vorgestellten Kostengrenze fällt es der Kammer schwer, zu beurteilen, ob es tatsächlich einen Betrag gab, den die Kläger nicht zu überschreiten bereit waren und falls ja, welcher dieses gewesen sein könnte.
Insbesondere sieht sich die Kammer nicht in der Lage, festzustellen, ob mit dem Betrag von 1.207.850,00 € eine für die Kläger akzeptable Kostengrenze überschritten wurde. Dieser Betrag findet sich in einer Kostenschätzung der Beklagten, die die Kläger erstmals mit dem in der Verhandlung vom 4.6.2020 nachgelassenen Schriftsatz vorlegen, zu dem die Beklagte noch keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen wesentlich anderen Ausbau des Wasserturms mit mehreren Wohnungen. Festzustellen ist lediglich, dass diese Art der Planung mit der verbundenen Kostenschätzung nicht zur Ausführung kam. Dass Grund hierfür eine Überschreitung der für die Kläger akzeptablen Kosten war und dass die Kläger der Beklagten dies im ersten Termin am 28.4.2009 mitgeteilt hätten, stellt eine bloße Behauptung der Kläger dar. Dieser steht die Aussage der Beklagten entgegen, wonach im ersten Termin am 28.4.2009 über Kosten gar nicht gesprochen worden sei und es sich bei den damals vorliegenden Unterlagen lediglich um eine Machbarkeitsstudie gehandelt habe - ein Begriff, der sich in den klägerseits vorgelegten Unterlagen wiederfindet. Die Kammer vermag insoweit nicht einzuschätzen, wessen Angaben der Wahrheit entsprechen. Grundsätzlich haben beide Parteien in ihrer persönlichen Anhörung nicht den Eindruck erweckt, bewusst unzutreffend vorzutragen. Widersprüche im Vortrag der Kläger ergeben sich im Wesentlichen im Hinblick auf den schriftsätzlichen Vortrag, auf dessen Richtigkeit die Kläger grundsätzlich allerdings ebenfalls hinwirken sollten. Die Beklagte wirkte in jeder mündlichen Verhandlung, insbesondere auch schon während des abgetrennten Verfahrensteils und bei der - nach dem weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr erheblichen - Sachverständigenanhörung in besonderem Maße sachorientiert. Sie erweckte an keiner Stelle den Eindruck, den Sachverhalt zu ihren Gunsten verändern zu wollen, sondern stets den Eindruck einer gewissenhaften Befassung mit der Sache. Zu bemerken ist, dass die Beklagte nie behauptete, dass die Kläger geäußert hätten, der Preis spiele für sie keine wesentliche Rolle - ein Vortrag, der bei einer weniger an der Wahrheit als am eigenen Vorteil orientierten Partei naheliegender gewesen wäre, als die Behauptung, es sei über die Kostenvorstellungen der Kläger nicht gesprochen worden, womit die Beklagte sich gleichzeitig dem Vorwurf des nicht ausreichenden Erfragens eben dieser Vorstellungen aussetzt. Andererseits spricht der Wortlaut der Email vom 23.5.2009 durchaus dafür, dass Kostenvorstellungen der Kläger zuvor erörtert wurden. Ob dies aber im Zusammenhang mit einer Obergrenze des von den Klägern für das Projekt angesetzten Budgets der Fall war, vermag die Kammer ebenso wenig zu sagen wie, ob es für die Kläger eine solche Obergrenze überhaupt gab.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Kläger zuvor in einem Einfamilienhaus wohnten, das nach ihrer Darstellung einen Wert von weniger als 400.000,00 € hatte. Denn dies schließt nicht aus, dass sie bereit gewesen wären, einen wesentlich höheren Betrag für die Baukosten des Wasserturms auszugeben. Die Kläger selbst schilderten, dass nach ihrer Vorstellung in dem Wasserturm eine Luxuswohnung entstehen sollte. Eine Luxuswohnung in einem Wasserturm ist mit einem Einfamilienhaus - auch gehobenen Standards - nur in Grenzen vergleichbar, sodass sich keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen, welche Kosten die Kläger auf sich zu nehmen bereit waren. Die Änderung der Wohnsituation war in jedem Fall mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden - wie hoch diese zusätzlichen Kosten sein durften, ergibt sich aus der ursprünglichen Wohnsituation nicht.
Es lässt sich auch nichts zu Gunsten der Kläger daraus herleiten, dass sie im Verlauf des Bauvorhabens auf die Einhaltung der prognostizierten Kosten drängten. Die Kammer zweifelt nicht daran, dass die Kläger sich an der Kostenschätzung vom 22.5.2009 orientierten und dass diese auch Grundlage der geplanten Finanzierung war. Es ist daher nachvollziehbar, wenn sie deren Einhaltung erwarteten. Sofern die Kosten tatsächlich ohne Beauftragung von Zusatzleistungen um mehrere 100.000,00 € über den prognostizierten Kosten gelegen haben sollten, ist verständlich, wenn die Kläger hierauf ungehalten reagieren. Dies gilt insbesondere für den Kläger, der als Geschäftsmann nach Einschätzung der Kammer daran gewöhnt war, Kosten und Gewinne zutreffend zu kalkulieren und von dem daher anzunehmen ist, dass er dies auch von der Beklagten erwartete. Der Ärger der Kläger über die Nichteinhaltung der prognostizierten Kosten sagt gleichwohl nichts darüber aus, wie sie sich verhalten hätten, wenn ihnen die höheren Kosten von vornherein bekannt gewesen wären. Dies zeigt beispielhaft die Reaktion des Zeugen Z1, der in nachträglich sich herausstellenden Mehrkosten von 400.000,00 € sowohl für den Bauherrn als auch für die finanzierende Bank ein erhebliches Problem sah, während er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass die Kläger bei ursprünglich entsprechend höheren Kosten einen solchen Betrag nicht hätten finanzieren können. Fraglich wäre, ob sie dies gewollt hätten, was sich im Nachhinein nur schwer beantworten lässt.
Dafür, dass die Kläger bereit gewesen, Baukosten von 1.136.000,00 € in Kauf zu nehmen, spricht insbesondere die Begeisterung der Kläger für das Projekt. Der Umbau des Wasserturms zu Wohnzwecken ist nicht alltäglich, sondern entsprang der eigenen, kreativen Idee der Kläger. Ein solches Projekt ist ohne eine besondere Begeisterung hierfür praktisch nicht denkbar. Nicht nur die Beklagte schilderte, dass die Kläger für das Projekt "brannten", sondern auch die Zeugin Z2 erinnerte sich daran, dass bei den Klägern "ein ganz großer Idealismus" vorhanden gewesen sei. Nach Ansicht der Kammer hätte diese Begeisterung in Kombination mit den finanziellen Möglichkeiten zumindest dazu führen können, dass die Kläger auch ein größeres Budget in Kauf genommen hätten. Die Zeugin Z2 hat hierzu insbesondere nichts Gegenteiliges geäußert, sondern erklärt, dass sie nichts darüber sagen könne, was die Kläger auszugeben bereit gewesen wären.
Insgesamt ist damit aus Sicht der Kammer zwar denkbar, dass die Kläger sich selbst das Budget von 1 Million € vorgestellt hatten. Bei einem Geschäftsmann wie dem Kläger erscheint es durchaus plausibel, dass dieser trotz seines großen Vermögens auch bei privaten Ausgaben bestimmte Kostenvorstellungen entwickelt. Ebenso deutet die von dem Kläger erstellte Vermögensübersicht nicht darauf hin, dass die Kläger erhebliche Risiken bei der Anlage ihres Vermögens eingingen. Es scheint daher nicht fernliegend, dass die Kläger auch für das eigene Wohnprojekt einen Kostenrahmen im Kopf hatten, dessen Einhaltung sie beabsichtigten. Wie sich die Kläger aber verhalten hätten, wenn sie von vornherein gewusst hätten, dass dieser Kostenrahmen nicht umsetzbar ist, vermag die Kammer nicht zu sagen. Sicherlich ist eine Möglichkeit, dass die Kläger auf die Umsetzung des Projektes verzichtet hätten. Aus Sicht der Kammer besteht aber ebenso die Möglichkeit, dass sie lediglich die Finanzierung von vornherein angepasst und das Projekt genauso durchgeführt hätten, wie sie es tatsächlich durchgeführt haben.
Eine weitere Aufklärung durch Vernehmung des Zeugen Z3 hält die Kammer für entbehrlich. Die Kläger behaupten, sie hätten gegenüber dem Verkäufer des Grundstücks ihre Vorstellungen zu den Gesamtkosten des Bauprojektes geäußert und ihm mitgeteilt, dass sie höhere Kosten nicht finanzieren könnten. Es kann dahinstehen, ob die Kläger entsprechende Äußerungen gegenüber dem Zeugen Z3 getätigt haben. Jedenfalls würden diese nichts darüber aussagen, welchen Betrag die Kläger tatsächlich zu investieren bereit und in der Lage waren. Die Angabe eines niedrigen Betrages und die - nach der weiteren Beweisaufnahme nachweislich unzutreffende - Behauptung gegenüber dem Verkäufer, höhere Kosten nicht finanzieren zu können, könnte allein dem Zweck gedient haben, den Kaufpreis für das Grundstück zu reduzieren.
B) Mangels Hauptanspruchs besteht auch kein Zinsanspruch.
C) Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1, 2 ZPO.