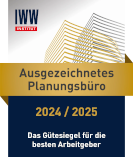20.08.2019 · IWW-Abrufnummer 210686
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht: Urteil vom 12.04.2019 – 1 U 147/14
Dieses Quellenmaterial (z. B. Original-Urteil) wurde bereits bei dem Gericht bzw. der Behörde angefordert, es liegt uns aber noch nicht vor.
Bitte versuchen Sie es in wenigen Tagen erneut.
1 U 147/14
11 O 260/11 LG Kiel
Verkündet am 12.04.2019
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil
Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit
hat der 1. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht xxx, den Richter am Oberlandesgericht xxx und den Richter am Oberlandesgericht xxx auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15.03.2019 für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 27.06.2014 verkündete Urteil des Einzelrichters der 11. Zivilkammer des Landgerichts Kiel hinsichtlich des Feststellungstenors teilweise geändert und wie folgt neu gefasst:
Gründe
I.
4. Den Klägern zu 1) und 2) steht ein Vorschuss in Höhe von 53.784,63 € brutto zu, den Klägern zu 3) und 4) ein Vorschuss in Höhe von 56.518,17 € brutto. Beide Beträge liegen über dem vom Landgericht Zugesprochenen.
Andererseits kann der Bauherr nicht verlangen, dass die Sanierung nach zurzeit einer Sanierungsplanung geltenden Vorschriften erfolgt, wenn diese Vorschriften später geändert werden. Denn er hat keinen Vorteil dadurch. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch eine Sanierung auf der Grundlage der zurzeit der Entscheidung gültigen Normen eine ausreichende Sicherheit geschaffen wird.
hh) Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Estrichplatte ist nur an acht statt an neunzehn Stellen notwendig, weil nur acht Zugstäbe notwendig sind statt der in der Sanierungsplanung angenommenen neunzehn Wandverbände. Die damit verbundenen Kosten reduzieren sich dadurch auf 445,84 € netto (Pos. 02.40), 561,44 € netto (Pos. 02.50) und 463,28 € netto (Pos. 02.60).
oo) Ebenso ist der Stundenlohn von zunächst 440,00 € netto (Pos. 03.100) vollständig anzusetzen. Bei Arbeiten in einem bestehenden Haus kann es wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten leicht zu Zusatzarbeiten kommen. Die zu bearbeitende Konstruktion ist verdeckt, so dass der genaue Aufwand im Vorhinein nicht abzuschätzen ist.
11 O 260/11 LG Kiel
Verkündet am 12.04.2019
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil
Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit
hat der 1. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht xxx, den Richter am Oberlandesgericht xxx und den Richter am Oberlandesgericht xxx auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15.03.2019 für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 27.06.2014 verkündete Urteil des Einzelrichters der 11. Zivilkammer des Landgerichts Kiel hinsichtlich des Feststellungstenors teilweise geändert und wie folgt neu gefasst:
Es wird festgestellt, dass der Beklagte den Klägern zu 1) und 2) alle weiteren Schäden zu ersetzen hat, die aufgrund der Mängel im Haus L......... 11 (Rissbildung im Obergeschoss an allen Gebäudeaußenwänden, der Gebäudetrennwand und den Gebäudeinnenwänden) entstehen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte den Klägern zu 3) und 4) alle weiteren Schäden zu ersetzen hat, der aufgrund der Mängel im Haus L......... 9 (Rissbildung im Obergeschoss an allen Gebäudeaußenwänden, der Gebäudetrennwand und den Gebäudeinnenwänden) entstehen.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
Der Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Dem Beklagten bleibt nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Gründe
I.
Die Kläger verlangen von dem Beklagten aus übergegangenem Recht Schadensersatz in Form eines Vorschusses wegen statischer Mängel ihrer Doppelhaushälften.
Die Kläger zu 1) und 2) und der Bauunternehmer B1 schlossen am 01.02./26.01.2005 einen Bauvertrag über die Errichtung einer Doppelhaushälfte auf dem Grundstück der Kläger zu 1) und 2) (Anlage K 3, AB I). Die Kläger zu 3) und 4) schlossen am 02.08.2005 mit Herrn B1 einen Bauträgervertrag über die Errichtung der benachbarten Doppelhaushälfte (Anlage K 4, AB I). Herr B1 beauftragte den Beklagten jedenfalls mit der Genehmigungsplanung und der Tragwerksplanung bis zur Genehmigungsplanung. Die Bauleitung übernahm er selbst. Während der Bauphase kam es zu Streitigkeiten über die Ausbildung einer Schwelle als Grundlage für die Dachkonstruktion. In diesem Zusammenhang erstellte der Beklagte im Auftrag von Herrn B1 eine Nachtragsstatik.
Nach einem Sturm traten in der Doppelhaushälfte der Kläger zu 1) und 2) in den Jahren 2006/07 Risse auf. Auch in der Doppelhaushälfte der Kläger zu 3) und 4) traten Risse auf. Der von der Gebäudeversicherung beauftragte Gutachter vertrat die Auffassung, dass die Risse ihre Ursache in einer fehlerhaften Statik hätten.
Durch Vereinbarungen vom 23/29.06.2008 und 23.06./06.07.2008 (Anlagen K 1 und K 2, AB I) trat Herr B1 seine Ansprüche gegen den Beklagten an die Kläger zu 1) und 2) bzw. die Kläger zu 3) und 4) ab.
In der Folgezeit leiteten die Kläger ein selbständiges Beweisverfahren ein (Landgericht Kiel 11 OH 34/08), in dem der Sachverständige S1 sein Gutachten vom 01.02.2010 mit Ergänzungsgutachten vom 23.11.2010 und 22.03.2011 erstellte.
Die Kläger haben behauptet, Herr B1 habe den Beklagten mit der Erbringung sämtlicher Statikerleistungen und dem gesamten Bauentwurf beauftragt.
Ursache der Bauschäden in den Doppelhaushälften sei die mangelhafte Statik des Beklagten. Für die Sanierung würden 88.615,30 € netto im Falle der Doppelhaushälfte der Kläger zu 1) und 2) bzw. 90.545,63 € netto im Falle der Doppelhaushälfte der Beklagten zu 3) und 4) entstehen, später korrigiert auf 55.051,60 € bzw. 56.931,93 € netto. Wegen der Einzelheiten wird auf Bl. 8 - 10 der Akte Bezug genommen.
Die Kläger haben zuletzt die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 55.051,60 € nebst Zinsen und Kosten an die Kläger zu 1) und 2) und 56.931,93 € nebst Zinsen und Kosten an die Kläger zu 3) und 4) sowie die Feststellung begehrt, dass der Beklagte auch weitere Schäden zu ersetzen hat. Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt.
Der Beklagte hat behauptet, er habe im Jahr 2005 noch nach den Normen DIN 1055-4 1986 und DIN 1052 1988 rechnen dürfen.
Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen der näheren Einzelheiten gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat unter Würdigung des Sachverständigengutachtens aus dem selbständigen Beweisverfahren und nach Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens den Beklagten unter Klagabweisung im Übrigen zur Zahlung von 52.211,60 € nebst Zinsen und Kosten an die Kläger zu 1) und 2) und 54.141,92 € nebst Zinsen und Kosten an die Kläger zu 3) und 4) verurteilt sowie die begehrte Feststellung getroffen. Es hat ausgeführt, die Kläger könnten Schadensersatzansprüche wegen der mangelhaften Statik geltend machen, die sich in Mängeln des Bauwerks manifestiert habe. In der Statik des Beklagten fehle eine Aussage zur Bewältigung der Windsogkräfte, die nach den Ausführungen des Sachverständigen schon nach der damaligen DIN notwendig gewesen wäre. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien dadurch Risse in den Doppelhaushälften entstanden. Herrn B1 treffe kein Mitverschulden, weil er die Statik nicht habe prüfen können.
Die Mangelbeseitigungskosten seien unstreitig. Ein Wille des Beklagten, sie zu bestreiten, sei nicht feststellbar. Jedoch hätten die Kläger die Malerkosten doppelt berücksichtigt.
Gegen dieses Urteil richtet sich die frist- und formgerecht eingelegte und begründete Berufung des Beklagten. Er führt im Wesentlichen aus, das Landgericht habe seinen Sachvortrag nicht berücksichtigt und Beweisanträge übergangen.
Er habe den Nachweis für die Ableitung der Windsogkräfte jetzt durch Berechnung vom 06.10.2014 (Bl. 189 bis 244 d. A.) erbracht.
Nach den Ausführungen des Sachverständigen habe zur Aussteifung des Gebäudes die Ausbildung des Ringbalkens ausgereicht. Die Planung sei jedoch erst in der Ausführungsplanung zu erbringen gewesen, mit der er nicht beauftragt gewesen sei.
Die Kausalität der Mängel der Statik für die Mängel des Gebäudes sei nicht aufgeklärt worden. Tatsächlich könne das Gebäude fehlerfrei gebaut sein. Die Dachscheibe habe nach den Ausführungen des Sachverständigen keines rechnerischen Nachweises bedurft. Die Risse im Erdgeschoss hätten nach den Ausführungen des Sachverständigen andere Ursachen. Die Häuser seien mangelhaft gebaut, z.B. habe sich Feuchtigkeit in den Häusern befunden, die beim Austrocknen zu den Rissen im Obergeschoss geführt habe.
Die Verantwortung von Herrn B1 als Bauleiter sei nicht berücksichtigt worden. Der Ringbalken sei abweichend von der Statik errichtet worden. Herrn B1 treffe auch ein Mitverschulden, weil er auf eine Ausführungsplanung und eine Bauüberwachung durch einen Statiker verzichtet habe.
Sonst wären die Mängel aufgefallen.
Die Höhe der Mangelbeseitigungskosten sei streitig gewesen. Nach den Ausführungen des Sachverständigen reiche zudem zur Sanierung der Einbau von Aussteifungsverbänden, wodurch die Kosten niedriger ausfielen. Auch sei der Sanierungsplanung die alte Norm zugrunde zu legen.
Der Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen.
Die Kläger beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das Urteil des Landgerichts unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vortags. Unter anderem bestreiten sie den Inhalt der Berechnung vom 06.10.2014 und bestreiten, dass die Risse im Obergeschoss auf einer mangelhaften Errichtung der Gebäude beruhten.
Als Reaktion auf das Urteil des BGH vom 22.02.2018 (VII ZR 46/17) verlangen die Kläger nunmehr Schadensersatz in Form eines Kostenvorschusses.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat Beweis erhoben aufgrund der Beweisbeschlüsse vom 26.04.2016 (Bl. 299 d. A.), 19.12.2016 (Bl. 326 d. A.) und 23.02.2018 (Bl. 402 - 403 d. A.) sowie der Verfügung vom 25.07.2017 (Bl. 358 d. A.) durch Einholung ergänzender Sachverständigengutachten und Anhörung des Sachverständigen. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Gutachten des Sachverständigen S2 vom 08.10.2016, 09.06.2017 und 10.08.2018 sowie das Protokoll des Termins vom 19.01.2018 (Bl. 375 - 380 d. A.) Bezug genommen.
II.
Die zulässige Berufung hat in der Sache nur bezüglich des Feststellungstenors teilweise Erfolg. Das Landgericht hat den Beklagten auch unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage zu Recht zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.
1. Den Klägern steht gegen den Beklagten aus übergegangenem Recht ein Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB zu. Sie haben sich die Ansprüche von Herrn B1 gegen den Beklagten abtreten lassen. Herr B1 und der Beklagte hatten einen Werkvertrag geschlossen, nämlich einen Ingenieurvertrag.
Der Schadensersatzanspruch steht den Klägern in Form eines zweckgebundenen Betrages, über den abzurechnen ist, zu. Ein Bauherr, der den Baumangel noch nicht hat beseitigen lassen, kann seinen Schaden nicht in Höhe der fiktiven Mangelbeseitigungskosten berechnen. Er kann aber auch von einem Statiker Schadensersatz in Form eines Vorschusses in Höhe der voraussichtlichen Mangelbeseitigungskosten verlangen, damit ihn die Nachteile der Vorfinanzierung der Mangelbeseitigung nicht treffen (BGH, Urteil vom 22.02.2018, VII ZR 46/17, Rn. 30 ff., 60 ff., 66 f.).
Die Kläger können zur Forderung dieses Vorschusses übergehen, obwohl sie keine Anschlussberufung eingelegt haben. Denn nach § 264 Nr. 2 ZPO liegt keine Klageänderung vor. Die Kläger beschränken den bisherigen Klageantrag, weil sie statt eines Betrages, den sie endgültig behalten können, einen Betrag fordern, über den sie abrechnen müssen. Nach wie vor handelt es sich aber um Schadensersatz. Der Vorschuss soll dabei den Schaden durch eine sonst notwendig werdende Vorfinanzierung abwenden.
2. Die von dem Beklagten erstellte Statik ist mangelhaft. Das hat zur Rissen in den Obergeschossen der Häuser geführt. Zudem müssen die Gebäude statisch ertüchtigt werden. Davon ist der Senat nach der Ergänzung der Beweisaufnahme überzeugt. Die Ergänzung war notwendig, weil das Landgericht teilweise den Einwendungen des Beklagten nicht hinreichend nachgegangen ist.
a) Die Statik des Beklagten ist mangelhaft, weil er die Ableitung von Windsogkräften nicht nachgewiesen hat.
aa) Der Beklagte schuldete zwar nur eine Genehmigungsplanung für die Statik, hätte dabei aber bereits die notwendigen Nachweise führen müssen.
Der Beklagte hatte den Auftrag, die Genehmigungsplanung für das Bauwerk sowie die Tragwerksplanung bis zur Genehmigungsplanung durchzuführen. Einen weitergehenden Auftrag auch für die Ausführungsplanung oder Bauüberwachungsleistungen haben die Kläger nicht bewiesen. Der als Zeuge vernommene Herr B1 hat das nicht bestätigt (Prot. v. 12.06.2012, Bl. 49 f. d. A.).
Der Beklagte schuldete aber bereits in der Genehmigungsplanung nicht nur eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung, sondern nach § 64 Abs. 3 HOAI a. F. bereits eine prüffähige statische Berechnung, während für die Ausführungsplanung nur noch das Durcharbeiten der Ergebnisse der Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorgesehen ist. Geschuldet ist bereits der Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit des geplanten Gebäudes (Locher/Koeble/Frik, HOAI, 9. Aufl., § 64, Rn. 36).
Soweit der Beklagte meint, eine Kausalität seiner Statik für die eingetretenen Bauschäden stehe auch deswegen infrage, weil er öffentlich-rechtlich bei der Genehmigungsplanung von der alten Norm habe ausgehen dürfen, während Herr B1 bei der Errichtung des Gebäudes privatrechtlich die neue Norm habe zugrunde legen müssen, ist das treuwidrig. Der Beklagte kann sich nicht darauf berufen, nach der alten Norm den Standsicherheitsnachweis geführt zu haben, wenn er den Auftraggeber nicht darauf hinweist, dass seine Ergebnisse nach der neuen Norm überholt und deswegen Schäden zu erwarten sind.
bb) Die Sachverständigen S1 und S2 haben übereinstimmend ausgeführt (GA v. 01.02.2010, Bl. 354 in 11 OH 34/08; GA v. 17.01.2014, Bl. 100 f. d. A.), dass der Nachweis der Ableitung von Windsogkräften in der ihnen vorliegenden Statik nicht geführt ist. Er wäre auch nach der alten DIN notwendig gewesen, nach der der Beklagte zum Zeitpunkt der Erstellung der Statik im Jahr 2005 noch arbeiten durfte, wie der Sachverständige S2 ausgeführt hat (Prot. v. 22.05.2014, Bl. 130 f. d. A.).
Den Nachweis der Ableitung der Windsogkräfte hat der Beklagte auch mit seiner Berechnung vom 06.10.2014 (Bl. 189 - 244 d. A.) nicht geführt.
Der Senat hat diese Berechnung sachverständig überprüfen lassen. Denn Sinn der Statik ist nachzuweisen, ob und ggf. wie das geplante Gebäude konstruktiv standsicher errichtet werden kann. Hätte sich erweisen lassen, dass der Nachweis für die von dem Beklagten gewählt Konstruktion gelingt, hätte er für die dennoch aufgetretenen Risse nicht verantwortlich gemacht werden können.
Im Gutachten vom 08.10.2016 hat der Sachverständige S2 ausgeführt, der Beklagte habe mit einer ungeeigneten Formel gerechnet. Die von ihm verwendete Formel betreffe die Verbindungsmittel zwischen dem Dachstuhl und dem Ringbalken, deren ausreichende Tragfähigkeit nicht infrage stehe. Problematisch sei die Fuge zwischen Ringbalken und Wandkrone. Hier habe der Beklagte nicht mit dem erforderlichen Sicherheitsbeiwert für die Windsogkräfte und mit einem zu hohen Gewicht des Ringbalkens gerechnet. Vergleichsrechnungen zeigten, dass in weiten Teilen über dem Mauerwerk abhebende Kräfte entstehen könnten. Dabei seien auch Wechselwirkungen zwischen zwei Auflagerpunkten berücksichtigt worden, was eine Berechnung mit Einzelsystemen nicht leisten könne.
Im Ergänzungsgutachten vom 09.06.2017 hat der Sachverständige auf die Einwendungen des Beklagten weiter ausgeführt, nach dem Wortlaut der Ziff. 3.3 der DIN 1055-4 gelte die zu erreichende Sicherheitszahl auch für einzelne Bauteile. Er bleibe dabei, dass die Formel in der Anmerkung nur für Verbindungsmittel gelten könne, auch wenn er eine Kommentierung dazu nicht gefunden habe. Was das Gewicht des Ringbalkens angehe, sei er bei seiner Berechnung von dem in der Statik des Beklagten vorgesehenen leichteren U-Stein ausgegangen. Den Fotos im Gutachten des Sachverständigen S1 sei aber zu entnehmen, dass tatsächlich eine schwerere U-Schalung eingebaut worden sei. Eine neue Vergleichsrechnung mit dem höheren Gewicht und einer Reduzierung mit dem Faktor 0,9 nach dem heutigen Sicherheitskonzept bei gesicherten Lastannahmen führe dazu, dass die Sicherheit von 1,5 immer noch nicht eingehalten werde.
Im Termin vom 19.01.2018 (Prot. Bl. 375 - 379 d. A.) hat der Sachverständige ergänzt, die Unterschiede seiner Berechnung und der Berechnung des Beklagten ergäben sich u. a. aus der Berücksichtigung von Nachbarbereichen. Der Beklagte habe dort, wo die Sicherheit nicht erreicht werde, auf die ausreichende Sicherheit dort abgestellt, während nach seiner Berechnung die Sicherheit dort aufgezehrt werde. Auch beim Ansatz einer einfachen Sicherheit ergäben sich kleine Bereiche, in denen Dach und Ringbalken abheben könnten. Hinsichtlich des Ringbalkens sei davon auszugehen, dass das Gewicht einer mit Beton ausgegossenen U-Schale etwas geringer sei als das Gewicht eines massiven Betonbalkens. Den vom Beklagten angenommenen Wert würde man z. B. für hoch bewehrten Beton ansetzen. Wenn es um abhebende Kräfte gehe, würde er den geringeren Wert ansetzen.
Die Einwendungen des Beklagten sind durch die Ausführungen des Sachverständigen widerlegt. Der Senat ist davon überzeugt, dass diese Ausführungen richtig sind. Der Sachverständige ist sachgerecht vorgegangen, indem er die notwendigen Unterlagen und Vorschriften herangezogen hat. Er hat die notwendigen eigenen Berechnungen angestellt. Er ist auf die Einwendungen der Parteien eingegangen und hat seine Auffassung dabei z. T. relativiert. Seine Ausführungen sind nachvollziehbar. An seiner Fachkunde bestehen keine Zweifel.
Die Einwendungen des Beklagten betrafen zum einen die Frage, ob die Sicherheitszahl von 1,5 nur erreicht werden müsse, wenn das Gesamtsystem betrachtet werde oder auch mit Teilsicherheitszahlen gerechnet werden dürfe, zum anderen den Ansatz des Gewichts für den Ringbalken, dass er genau ermittelt habe. Demgegenüber sind die Ausführungen des Sachverständigen plausibler.
Die von dem Beklagten verwendete Formel sieht als Faktor u. a. die größte von dem Verbindungsmittel aufnehmbare Kraft vor. Aus der Statik des Beklagten wird nicht deutlich, welchen Wert er dafür eingesetzt hat oder hätte ansetzen können. Es geht nämlich um die Grenze zwischen der Mauerkrone und dem auflagernden Ringbalken, wo Verbindungsmittel, anders als zwischen dem Ringbalken und den Sparren, nicht vorhanden sind.
Zu der Frage, ob eine Gesamtsicherheitszahl oder Teilsicherheitszahlen zu berücksichtigen sind, verhält sich der Beklagte widersprüchlich.
Nachdem er zunächst geltend gemacht hat, er habe zulässigerweise mit Teilsicherheitszahlen gerechnet, hat er zuletzt gemeint, es sei mit einer Gesamtsicherheitszahl zu rechnen, der Sachverständige rechne dagegen mit Teilsicherheitszahlen.
Was das Gewicht des Ringbalkens angeht, so ist es nachvollziehbar, dass ein massiver Betonbalken ein größeres Gewicht hat als ein ausgegossenes Formteil. Ebenso ist nachvollziehbar, dass zur Sicherheit das geringere Gewicht anzusetzen ist, wenn es um abhebende Kräfte geht. Auch der Beklagte hat das von ihm angenommene Gewicht nur Tabellen entnommen und es nicht konkret etwa durch Nachwiegen ermittelt.
Im Interesse der Sicherheit ist es dann sachgerecht, einen Abschlag zu machen.
b) Der Beklagte hat die Belastung der Traufwand in senkrechter Richtung nicht nachgewiesen. Der Sachverständige hat dazu auch insoweit überzeugend im Ergänzungsgutachten vom 09.06.2017 (S. 13 ff.) ausgeführt, der Nachweis sei nach der Norm vorgeschrieben. Er könne nach eigener Berechnung auch unter Zugrundelegung der von dem Beklagten angenommenen Werte nicht gelingen.
Im Termin vom 19.01.2018 hat der Sachverständige ergänzt, dies sei gegenüber der nicht nachgewiesenen Ableitung der Windsogkräfte der gravierendere Mangel. Die Wand sei angesichts ihrer Höhe zu dünn. Sie halte dem auftreffenden Wind nicht stand. Sie werde oben nicht gehalten, da das Dach abheben könne. Auf den Einwand des Beklagten hat er erwidert, das Gewicht des Sturzes unterhalb der Mauerkrone habe damit nichts zu tun. Entscheidend sei das Kopfmoment. Das Dach sitze nicht mittig auf der Mauerkrone. Bereits dadurch erhalte die Wand einen Impuls, der sich nach untern fortsetze.
c) Ob die Dachscheibe richtig ausgebildet ist, kann offen bleiben. Der Beklagte war für ihre Konstruktion nicht verantwortlich.
Zwar hat der Sachverständige S1 bemängelt, dass der Nachweis der Dachscheibe in der Statik des Beklagten fehle (GA v. 01.02.2010, Bl. 354, 356 in 11 OH 34/08). Der Sachverständige S2 hat aber präzisiert, dass der Nachweis nach der alten DIN, nach der der Beklagte seinerzeit habe rechnen dürfen, nicht vorgeschrieben gewesen sei. Allerdings sei in einem solchen Fall anzuraten gewesen, den Auszug aus der Holzbau-DIN über die Errichtung von Dachscheiben der Statik beizufügen, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass alle Zimmerleute Kenntnis von der richtigen Ausführung hätten (GA v. 17.01.2014, Bl. 99, 100 f. d. A.).
Es ist aber wiederum zu berücksichtigen, dass der Beklagte nur die Genehmigungsplanung schuldete. Den Hinweis auf die Holzbau-DIN hätte man erst für die Ausführungsplanung erwarten dürfen. Er war der Genehmigungsplanung nicht beizulegen, weil deren Adressat nicht der Zimmermann war.
Der Beklagte schuldete nicht deswegen mehr, weil er und der Bauunternehmer bewusst auf eine Ausführungsplanung und Bauüberwachung verzichteten. Dieses Risiko ist der Bauunternehmer bewusst - wohl aus Kostengründen - eingegangen. Da die Kläger dessen Anspruch geltend machen, müssen sie die Folgen dieser Entscheidung tragen.
c) In der Statik des Beklagten fehlen Angaben zum Anschluss des Dachstuhls an den Giebel. Bereits der Sachverständigen S1 hat ausgeführt, dass der von dem Beklagten vorgesehene Anschluss mit drei Schürmanneisen unzureichend sei (S. 11 des Gutachtens, Bl. 355 in 11 OH 34/08).
Der Beklagte behauptet, die Schürmanneisen seien nur irrtümlich in seiner Statik aufgeführt worden. Tatsächlich sei die Befestigung mit Stichsparren erfolgt, was ordnungsgemäß gewesen sei.
Der Sachverständige S2 hat dazu im Gutachten vom 08.10.2017 auch insoweit überzeugend ausgeführt, grundsätzlich sei der Anschluss mit Schürmanneisen als diagonal angeordneten Zugbändern sinnvoll, um die Giebelwände zu stabilisieren. Es fehlten in der Statik aber eine Darstellung im Positionsplan und damit Angaben zur konstruktiven Ausbildung. Eine ersatzweise Anordnung von Stichsparren - senkrecht mit den Sparren verbundenen Hölzern - sei nicht ausreichend.
Im Termin vom 19.01.2018 hat er auf den Einwand des Beklagten, er verstehe unter Stichsparren solche, die mit Ringbalken und Sparren verbunden seien und den Dachrand mit ausbildeten, erwidert er erkenne nicht, wie das gegen abhebende Kräfte wirken könne. Das ist überzeugend, weil die Art der Ausbildung des Dachrandes keinen Einfluss auf die Verbindung zwischen Wand und Dachstuhl hat.
d) Der Ringbalken ist mangelhaft ausgeführt worden. Er ist durch auflagernde Pfetten unterbrochen. Ferner sind die auf den Innenwänden aufliegenden Ringbalken nicht fest mit dem auf den Außenwänden umlaufenden Ringbalken verbunden. Das führt bei Einwirkungen auf den Dachstuhl, der über Schwellen mit dem Ringbalken verbunden ist, zu Verschiebungen des Ringbalkens und damit zu Rissen, wie der Sachverständige S1 in seinem Gutachten ausgeführt hat (GA v. 01.02.2010, Bl. 354 f. in 11 OH 34/08). Die mangelhafte Ausführung ist teils dem Beklagten, teils Herrn B1 als Bauausführendem anzulasten.
Dass der Beklagte nur eine Genehmigungsplanung zu liefern hatte, hat Auswirkungen auf seine Verantwortlichkeit für die Mängel des Ringbalkens.
Die vom Sachverständigen S1 vermissten Angaben zur Bewehrungsführung in den Ecken (Protkoll vom 12.06.2012, S. 4, Bl. 51 d. A.) waren erst in der Ausführungsplanung zu machen. Erst dabei sind Bewehrungspläne als Anleitung für die Verlegung der Bewehrung zu erstellen (Locher/ Koeble/Frik, HOAI, 9. Aufl., § 64, Rn. 45).
Vorzuwerfen ist dem Beklagten aber, dass die Unterbrechung des Ringbalkens durch Pfetten bereits auf den Bauzeichnungen - die im Übrigen von ihm selbst stammten - zu erkennen war (GA v. 01.02.2010, S. 10, Bl. 354 in 11 OH 34/08; Prot. v. 12.06.2012, S. 4, Bl. 51 d. A.). Der Beklagte behauptet, dass es verschiedene konstruktive Möglichkeiten gebe, um das Problem zu lösen, etwa den Ringbalken durch einen Knick nach unten unter der Pfette hindurchzuführen oder Ringbalken und Pfette durch U-Eisen miteinander zu verbinden. Er meint, eine solche Planung sei erst Gegenstand der Ausführungsplanung gewesen. Das trifft nicht zu. Es war Aufgabe des Beklagten bereits in der Genehmigungsplanung, den Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des geplanten Gebäudes zu führen. Dann hätte er bereits konstruktive Vorgaben dazu machen müssen, wie der Ringbalken ausgestaltet werden sollte.
Danach kommt es nicht entscheidend darauf an, ob der Beklagte bei der Besichtigung der Baustelle wegen der Bohlen die falsche Ausführung des Ringbalkens bemerkt hat. Ihm war positiv bekannt, dass jedenfalls er keine ausreichenden Vorgaben für die Ausbildung gemacht hatte, und er konnte nicht davon ausgehen, dass jemand anderes solche Vorgaben gemacht hatte.
Ein Mitverschulden des Bauunternehmers B1 ist anzunehmen, weil ein Bauunternehmer wissen muss, dass ein Ringbalken nicht unterbrochen werden darf.
e) Die Befestigung des Dachstuhls über Bohlen statt über Schwellen hat nicht zu der Rissbildung beigetragen.
Zwar ist eine Instabilität des Dachstuhls nach dem Gutachten des Sachverständigen S1 dadurch entstanden, dass zur Befestigung auf dem Ringbalken nicht durchgehend, wie in der Statik vorgesehen, Schwellen, sondern teilweise elastischere Bohlen verwendet worden sind (GA v. 01.02.2010, Bl. 355 in 11 OH 34/08). Allerdings hat er die dazu von dem Beklagten erstellte Nachtragsstatik nicht überprüft, nach der die Verwendung von Bohlen unbedenklich ist.
Der Sachverständige S2 hat dazu im Gutachten vom 08.10.2017 auch insoweit überzeugend ausgeführt, die Annahme des Beklagten, dass die Bohle im Bereich des Vorbaus keine Zugkräfte aufnehmen müsse, weil die Auflasten aus dem Dach größer seien als die Windsogkräfte, so dass es unerheblich sei, dass eine biegeweiche Bohle statt der steiferen Schwelle eingebaut werde, sei im Ergebnis zutreffend. Zwar habe der Beklagte wiederum nicht mit den gebotenen Sicherheitsaufschlägen bzw. -abschlägen gerechnet, die Vergleichsrechnung zeige jedoch, dass zwar die geforderte 1,5-fache Sicherheit nicht erreicht werde, dennoch die Bohle keine Zugkräfte aufnehmen müsse.
Im Ergänzungsgutachten vom 09.06.2017 hat er auf den Einwand der Kläger eine ergänzende Berechnung vorgenommen. Danach ergibt sich bei einer Abminderung der aufliegenden Lasten auf 90 % nach dem heutigen Sicherheitskonzept eine Sicherheitszahl von 1,44. Das liege zwar unter 1,5, sei aber bei einer Abweichung von unter 5 % noch hinnehmbar.
f) Die Risse im Erdgeschoss der Häuser sind nicht auf die Mängel der Statik für das Dachgeschoss zurückzuführen. Nach den Ausführungen des Sachverständigen S1, die von den Klägern weder im selbständigen Beweisverfahren noch in der I. Instanz angegriffen worden sind, handelt es sich um Schwind- und Setzrisse.
Der Sachverständige S1 hat das in seinem Gutachten im Einzelnen ausgeführt und tritt damit der Auffassung des von der Gebäudeversicherung eingesetzten Privatgutachters R1 überzeugend entgegen. So führt er aus, dass auch bei dem bei der Aufmauerung der Wände verwendeten Porenbeton Schwindrisse möglich sind. Ferner führt er Faktoren auf, die zum Entstehen von Setzrissen geführt haben können, wie etwa den Umstand, dass es keine durchgehende Bodenplatte gibt, weil nur ein Teil des Gebäudes unterkellert ist, und die Tatsache, dass in der Bauphase die Fundamentgräben feuchtigkeitsbelastet waren (GA v. 01.02.2010, Bl. 358 ff. in 11 OH 34/08).
g) Die Risse in den Obergeschossen sind auf die mangelnde Standsicherheit des Gebäudes zurückzuführen, die Folge der mangelhaften Statik ist.
Von anderen möglichen Ursachen scheidet der weiche Baugrund nach den auch insoweit überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen aus.
Er hat im Ergänzungsgutachten vom 10.08.2018 angegeben, Setzrisse wegen eines zu weichen Baugrundes müssten sich überwiegend im Keller zeigen. Das ist plausibel, weil das Obergeschoss gegen Einwirkungen aus dem Baugrund durch die Betondecke über dem Erdgeschoss stabilisiert wird.
Der bloß theoretischen Möglichkeit weiterer Ursachen wie etwa das Zusammentreffen verschiedener Materialien oder nicht ausreichend im Verband gemauerte Steine muss nicht nachgegangen werden, weil die statischen Mängel die aufgetretenen Risse bereits ausreichend erklären.
Der Sachverständige hat dazu im Termin vom 19.01.2018 auch insoweit überzeugend ausgeführt, zur Erklärung reiche bereits, dass die Traufwand zu schlank sei. Durch das Kopfmoment bekomme die Wand im oberen Bereich einen Impuls, was Risse dort erkläre. Im Ergänzungsgutachten vom 10.08.2018 hat er weiter angegeben, nach seiner Einschätzung seien die Risse auf die mangelnde Auflast des Daches und damit die mögliche Abhebung in der Fuge zwischen Mauerwerk und Ringbalken zurückzuführen.
Dagegen spricht nicht, dass bereits auf Fotos aus der Bauphase Risse zu erkennen sind. Die Fotos aus dem selbständigen Beweisverfahren, auf die der Beklagte verweist (Schriftsatz vom 17.09.2018, Bl. 431 d. A.) belegen keine anderen Ursachen der Risse im Obergeschoss. Die Fotos auf Bl. 293 der Akte des selbständigen Beweisverfahrens sind im Erdgeschoss aufgenommen worden. Die anderen Fotos sind zwar im Obergeschoss entstanden, aber als das Dach bereits errichtet war, so dass dieselben Kräfte auf die Wände wirkten wie heute.
Die Fotos aus der Bauphase zeigen aber, dass es sich nicht um Trocknungsrisse handeln kann. Denn sie sind bereits im Rohbau entstanden, nicht erst nach Abschluss der Bauarbeiten im Zuge des Abtrocknens der Baufeuchtigkeit.
Die Annahme des Beklagten, wenn seit 2007 trotz schwerer Stürme keine weiteren Schäden entstanden seien, zeige dass, dass Baumängel Ursache der Risse gewesen seien, ist nicht zwingend. Wenn die Risse einmal eingetreten sind, weil sich der Dachstuhl und der Ringbalken auf der Mauerkrone bewegen, müssen sie sich nicht durch weitere Bewegungen sichtbar vertiefen.
3. Die Kläger müssen sich nach § 254 Abs. 1 BGB kein Mitverschulden des ursprünglichen Anspruchsinhabers B1 deswegen entgegenhalten lassen, weil er auf eine externe Bauleitung und eine Ausführungsplanung durch einen Statiker verzichtet hat.
Ein Mitverschulden setzt einen schuldhaften Sorgfaltsverstoß in eigenen Angelegenheiten voraus. Der Geschädigte muss eine im eigenen Interesse bestehende Obliegenheit verletzt haben, die ihn im Verhältnis zum Schädiger traf (BGH NZBau 2009, 185, 188). Eine solche Obliegenheit besteht im Falle eines Fehlers bei der Bauaufsicht nicht im Verhältnis des Bauherrn zum planenden Architekten, weil dieser keinen Anspruch auf eine fehlerfreie Bauaufsicht hat (BGH, a. a. O.; BGH NJW-RR 1989, 86, 89). Herr B1 mag öffentlich-rechtlich nach der LBO verpflichtet gewesen sein, den Bau durch einen Statiker überwachen zu lassen. Ein Verstoß dagegen kann ihn aber nur in dem Verhältnis zu den Bauherren schadenersatzpflichtig gemacht haben. Der Beklagte dagegen hatte ihm gegenüber keinen Anspruch darauf, dass seine Statik durch die Erstellung einer Ausführungsplanung oder durch eine Bauleitung in der Bauphase überprüft wird.
Soweit sich die Kläger ein Mitverschulden wegen der Ausführung des Ringbalkens anrechnen lasen müssen, hat das praktisch keine Auswirkungen.
Denn die zur Beseitigung der statischen Mängel vorgesehenen Arbeiten betreffen die Stabilisierung des Gebäudes gegen abhebende Lasten, aber nicht Arbeiten am Ringbalken.
a) Die Höhe des Vorschusses schätzt der Senat anhand der von den Klägern vorgelegten Angebote. Der Beklagte wendet sich nicht gegen die dort angesetzten Preise. Er wendet sich nur gegen die Notwendigkeit einzelner Arbeiten.
Eine überwiegende Sicherheit über die Höhe der voraussichtlichen Sanierungskosten ist nicht erforderlich. Dem Beklagten entsteht kein Nachteil, weil über den Vorschuss abzurechnen ist. Es reicht so eine Prognose, welche Maßnahmen zu welchen Kosten für die Beseitigung der festgestellten Mängel notwendig sein werden.
Der Vorschuss umfasst die anfallende Umsatzsteuer. Da über den Vorschuss abzurechnen ist, droht keine Überkompensation des Schadens (BGH, Urteil vom 22.07.2010, VII ZR 176/09, Rn. 13 ff, 16 bei juris; OLG Brandenburg, Urteil vom 15,06.2011, 4 U 144/10, Rn. 51 bei juris; OLG Stuttgart, Urteil vom 25.05.2011, 9 U 122/10, Rn. 67 bei juris).
b) Die Schätzung geht aus von der von den Klägern vorgelegten Sanierungsstatik des Statikers Zindel vom 17.01.2011 (Anlage K 19, AB II) und der Sanierungsplanung des Architekten Steuber (Anlage K 20, AB II). Es ist eine statische Verstärkung des Dach- und Wandbereichs notwendig.
Dadurch werden Begleitarbeiten wie Trockenbau-, Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten notwendig.
Die Richtigkeit der Sanierungsstatik ist grundsätzlich durch den Sachverständigen bestätigt worden. Im Gutachten vom 10.08.2018 hat er auch insoweit überzeugend ausgeführt, die Planung sehe die Herstellung einer Dachscheibe, die Herstellung von Wandscheiben und die Anbindung der Dachscheibe an die Wandverbände vor. Hinsichtlich der sogfesten Verbindung zwischen Sparren und Ringanker sei die von dem Beklagten vorgesehene Befestigung der Sparren auf einer Schwelle, die ihrerseits mit dem Ringbalken verbunden sei, grundsätzlich in Ordnung. Um ein Kippen der Sparren zu verhindern, seien aber z. T. Füllhölzer einzusetzen. Es sei eine Dachscheibe auszubilden, weil der Ringbalken keine ausreichende Tragfähigkeit bei horizontaler Einwirkung habe. Wegen der Windverbände entlang der Wände sei es zutreffend, dass die mangelhafte Sogverankerung durch Zuganker zu beheben sei. Nach seiner Berechnung nach den Vorgaben der aktuellen DIN sei es ausreichend, acht vertikale Zugstäbe einzubauen, während die in der Planung vorgesehenen Diagonalstäbe zur Herstellung von Verbänden entfallen könnten.
Auch seien die Verbände an den Innenwänden entbehrlich. Dadurch sei nur eine punktuelle Öffnung des Fußbodens erforderlich.
c) Welche Maßnahmen notwendig sind, bestimmt sich auf der Grundlage der aktuellen Normen. Der Beklagte muss hinnehmen, dass die heute geltenden Normen an den Nachweis der Ableitung von Windsogkräften strengere Anforderungen stellen als zur Zeit der Berechnung seiner Statik.
Andererseits müssen die Kläger es hinnehmen, dass bei einer Berechnung nach den heutigen Vorgaben zur Stabilisierung der Wände weniger Zugstäbe notwendig sind.
Kostensteigerungen, die auf Änderungen der Regeln der Technik zwischen der Abnahme und dem Auftreten des Mangels bzw. dessen Beseitigung beruhen, fallen grundsätzlich dem Werkunternehmer, der den Mangel zu vertreten hat, zur Last. Solche Kostensteigerungen sind allein durch ihn zu vertretenen, da er nicht mangelfrei geleistet hat. Es handelt sich nicht um Sowieso-Kosten da sie zur Bauzeit nicht angefallen wären. Ein Vorteilsausgleich kann erwogen werden, wenn dem Bauherrn ein erkennbarer Zusatznutzen durch die geänderte Bauweise entsteht (OLG Stuttgart NZBau 2012, 42, 43; OLG Stuttgart, Urteil vom 03.07.2012, 10 U 33/12, Rn. 100 bei juris). Dass das hier der Fall ist, ist nicht erkennbar, da es stets nur um die ausreichende Aussteifung des Gebäudes geht.
Soweit dagegen vertreten wird, die Mehrkosten durch die Änderung der Regeln der Technik seien von dem Unternehmer nicht auszugleichen, weil es keine rechtliche Grundlage für einen solchen Modernisierungszwang gebe (so OLG Hamm, Urteil vom 27.10.2006, 12 U 47/06, Rn. 58 bei juris), überzeugt das nicht. Zwar kann sich der Bauherr dafür entscheiden, sein Gebäude ohne die Einhaltung von Normen zu errichten bzw. zu sanieren. Er könnte mit dem Unternehmer abweichende Vereinbarungen treffen. Das ist ihm aber nicht zuzumuten. Denn die Normen stellen einen Mindestbestand der anerkannten Regeln der Technik dar. Sinn ist es, die Dauerhaftigkeit des Gebäudes zu sichern. Werden sie geändert, ist das ein Hinweis darauf, dass aufgrund neuer Erkenntnisse die überholten Normen dieses Ziel nicht mehr erreichen können. Man kann einem Bauherrn nicht anraten, dennoch nach alten Normen bauen bzw. sanieren zu lassen.
Das gilt erst recht, wenn die Standsicherheit des Gebäudes infrage steht. Gegenüber der alten Norm sind die anzusetzenden Windsogkräfte erhöht worden. Dadurch erhöht sich die Standsicherheit. Es ist den Klägern nicht zuzumuten, auf diesen Sicherheitszuschlag zu verzichten. Der Beklagte kann dagegen nicht einwenden, dass er nur für die Einhaltung der Regeln der Technik zurzeit der Abnahme - für die im Übrigen Vortrag fehlt - hafte. Das Problem entsteht eben erst dadurch, dass er mangelhaft gearbeitet hat. Mehrkosten wären nicht angefallen, wenn er die Regeln der Technik zur Bauzeit eingehalten hätte.
d) Die Kosten für die statische Ertüchtigung der Häuser schätzt der Senat aufgrund des Angebots der S3 & K1 GbR vom 15.06.2011 (in Anlage K 20, AB II) auf 14.343,06 € netto entsprechend 17.068,24 € brutto je Haus. Die Angebotspositionen sind für beide Häuser in Titel 1 und 2 gleich.
aa) Die Kosten für das Aufstellen von Staubschutzwänden von 1.368,00 € netto (Pos. 01.10) hält auch der Beklagte in seiner Kostenschätzung (Schriftsatz vom 21.01.2019, Bl. 466 ff. d. A.) für notwendig. Auch wenn die Eingriffe in die Wände nach den Ausführungen des Sachverständigen geringer ausfallen als in der Sanierungsstatik vorgesehen, sind jedenfalls acht Wandöffnungen zu fräsen, was alle Außenwände des Gebäudes betrifft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dabei zu einer Staubentwicklung kommt, die vom Erdgeschoss fernzuhalten ist.
bb) Die Kosten für das Totlegen der Elektroinstallation von 352,00 € netto (Pos. 01.20) und ggf. für die Wiederherstellung von 1.056,00 € netto und 300,00 € netto (Pos. 03.80 und 03.90) sind notwendig. Auch wenn die Diagonalverbände entfallen können, müssen acht Schlitze in die Wände gefräst werden, um die Zugstäbe dort einzubringen. Da man nicht sicher vorhersehen kann, ob man dabei auf Elektroleitungen trifft, ist die Installation aus Sicherheitsgründen vom Netz zu trennen und ggf. punktuell wieder herzustellen. Der genaue Aufwand dafür wird sich nach Abschluss der Arbeiten herausstellen.
cc) Die Kosten für das Aufnehmen der Bodenbeläge von 1.086,00 € netto (Pos. 01.30) sind notwendig. Es ist jedenfalls nötig, den Fußboden punktuell zu öffnen. Den Klägern ist nicht zuzumuten, dass die Löcher anschließend geflickt werden, abgesehen von der Unsicherheit, ob der Boden bei den anstehenden Arbeiten wirksam geschützt werden kann.
dd) Die Kosten für das Aufnehmen und die Wiederherstellung der Deckenverkleidung sind jeweils zur Hälfte anzusetzen, also mit 1.221,85 € netto (Pos. 01.40), 499,50 € netto (Pos. 03.10), 259,50 € netto (Pos. 03.20), 3099,00 € netto (Pos. 03.30) und 562,50 € netto (Pos. 03.40).
Die vollständige Entfernung des Deckenaufbaus ist nur für Arbeiten am Dachstuhl notwendig. Das betrifft die ggf. notwendige Herstellung einer Dachscheibe. Dafür ist der Beklagte, wie oben dargelegt, nicht verantwortlich.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass auch unabhängig von der Herstellung der Dachscheibe die Decke jedenfalls im Bereich der Außenwände geöffnet werden muss. Denn die Zugstäbe sollen im Ringbalken verklebt werden. Der Ringbalken muss voraussichtlich zugänglich gemacht werden, um das zu ermöglichen. Außerdem muss die Befestigung des Dachstuhls auf dem Ringbalken z. T. überarbeitet werden. Der Sachverständige zählt zwar, übereinstimmend mit der Sanierungsplanung, die sogfeste Verbindung zwischen Sparren und Ringbalken und den Windverband entlang der Firstwand zu der Herstellung der Dachscheibe. Ein Mangel ist aber auch, dass Angaben über die Anbindung zwischen Giebel und Dachstuhl fehlen.
Es ist nicht sicher vorauszusehen, welchen Aufwand die teilweise Entfernung der Dachverkleidung erfordert. Das hängt z. B. von dem Ausmaß der Gipskartonplatten ab, die im Randbereich entfernt werden müssen. Der Senat schätzt den Aufwand deswegen auf die Hälfte der im Angebot angesetzten Kosten.
ee) Die Kosten für eine Unterdruckanlage von 736,00 € netto (Pos. 01.50) und für das Entfernen der Türblätter von 112,00 € netto (Pos. 02.60) hält auch der Beklagte für notwendig. Wie bereits dargelegt, ist eine Staubentwicklung, die vom Erdgeschoss ferngehalten werden muss, nicht ausgeschlossen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Türen bei den anstehenden Arbeiten beschädigt werden.
ff) Für die sogfeste Verbindung durch Sparren-Ringanker (Pos. 02.10) ist der Beklagte nicht verantwortlich, so dass diese Position entfällt. Sie zählt zur Herstellung der Dachscheibe. Das geht aus der Sanierungsstatik hervor, die der Sachverständige im Gutachten vom 10.08.2018 als grundsätzlich richtig angesehen hat. Außerdem hat er dort ausgeführt, die von dem Beklagten vorgesehene Verankerung der Sparren auf dem Ringbalken über Schwellen sei ausreichend. Wie oben dargelegt, ist es unschädlich, dass z. T. statt der Schwellen Bohlen verwendet worden sind.
gg) Das Einbringen von Füllhölzern (Pos. 01.20) und das Anbringen von Lochbändern (Pos. 02.30) gehört unstreitig zur Herstellung der Dachscheibe. Diese Positionen sind nicht anzusetzen.
ii) Weil nur acht Zugstäbe statt neunzehn Wandverbände anzubringen sind, ergeben sich auch für die direkt betroffenen Positionen (Pos. 02.70 - 02.90) Änderungen.
Die Fußplatten entfallen zwar, weil die Zugstäbe eingeklebt werden sollen. Auch die Bohrungen in Betonplatte und Ringbalken und das Einkleben verursachen aber Kosten, so dass die Position 02.70 für acht statt neunzehn Stellen mit 517,20 € netto angesetzt wird.
Die Aussteifungsverbände selbst entfallen. Stattdessen sind acht Zugstäbe anzusetzen. Dafür wird zur Sicherheit der höhere Einheitspreis für acht Stück angesetzt, so dass sich für die Positionen 02.80 und 02.90 1.050,80 € netto ergeben.
jj) Die Positionen 02.110 - 02.120 mit 229,32 € netto, 1.901,40 € netto und 570,08 € netto sind anzusetzen. Der Senat rechnet sie zur Verbindung des Dachstuhls mit der Firstwand, die in der Statik des Beklagten nicht nachgewiesen ist.
kk) Die voraussichtlichen Kosten für die Rissverpressung mit 4.375,90 € netto (Pos. 02.130) und die Beiputzarbeiten (Pos. 02.140) sind für die Beseitigung der durch die statischen Mängel entstandenen Risse notwendig.
ll) Die Wandvorsatzschale (Pos. 03.50) entfällt, weil die Zugbänder, die sie verdecken sollte, nicht eingebaut werden. Stattdessen werden Wandschlitze zur Aufnahme der Zugstäbe gefräst.
mm) Die Raufasertapete (Pos. 03.60) wird nicht überall zu erneuern sein, sondern nur dort, wo die Zugstäbe eingebracht werden. Der Senat setzt diese Position wegen der Unsicherheit darüber, wie viele Tapetenbahnen durch die Arbeiten an Wänden und Decken beschädigt werden, mit 80 m² an.
nn) Dagegen sind die Malerkosten in Höhe von 664,00 € netto (Pos. 03.70) in voller Höhe zu berücksichtigen. Nach den zu erwartenden Eingriffen in Wände und Decken ist ein vollständiger Neuanstrich notwendig.
oo) Ebenso ist der Stundenlohn von zunächst 440,00 € netto (Pos. 03.100) vollständig anzusetzen. Bei Arbeiten in einem bestehenden Haus kann es wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten leicht zu Zusatzarbeiten kommen. Die zu bearbeitende Konstruktion ist verdeckt, so dass der genaue Aufwand im Vorhinein nicht abzuschätzen ist.
e) Die Kosten für die Neuverlegung von Bodenbelägen schätzt der Senat auf der Grundlage der Angebote der S4 & A1 GmbH vom 08.06.2011 und 01.08.2011 (in Anlage K 20, AB II) auf 4.047,35 € netto entsprechend 4.816,35 € brutto für das Haus der Kläger zu 1) und 2) und auf 6.145,50 € netto entsprechend 7.313,15 € brutto für das Haus der Kläger zu 3) und 4). Aus den Angeboten ergeben sich die Einzelpreise. Die Gesamtpreise sind im vorgehefteten Preisspiegel ausgewiesen.
Es bedarf keiner weiteren Darlegungen, welche Bodenbeläge sich in den Häusern befinden oder weswegen die geltend gemachten Beträge über dem Ausgangsangebot vom 08.06.2011 liegen. Die geltend gemachten Beträge ergeben sich aus dem Preisspiegel, indem die Einheitspreise aus dem Angebot für die notwendigen Positionen angesetzt werden. Z. B. ist das Aufnehmen der Bodenbeläge dort nicht eingeflossen, weswegen es unschädlich ist, dass auch das Angebot der S3 & K1 GbR unter Pos. 01.30 diese Arbeiten umfasst.
Wegen der Bodenbeläge hatte der Beklagte bereits in der ersten Instanz angemerkt, dass die geltend gemachten Kosten je Haus differieren. Die Kläger haben darauf vorgetragen (Ss. v. 06.12.2011, S. 5, Bl. 35 d. A.), dass im Haus der Kläger zu 1) und 2) Teppichboden verlegt ist und im Haus der Kläger zu 3) und 4) Parkett. Das ist unstreitig geblieben. Die Verlegung von Teppichboden bzw. Parkett ist auch im Preisspiegel vorgesehen.
Soweit im Angebot der S3 & K1 GbR die Entfernung von Teppichboden und Laminat (Pos. 01.30) und im Angebot der S4 & A1 GmbH das Aufnehmen von Laminat und Teppichboden und das Verlegen von Laminat, Kugelgarn, Nadelfilz und Linoleum sowie im Nachtragsangebot von Parkettboden vorgesehen sind, sind die Leistungsverzeichnisse möglicherweise nicht konkret genug erstellt worden. Das ändert nichts daran, dass die Art der vorhandenen Bodenbeläge unstreitig ist.
f) Für die Erstellung der Sanierungsstatik können die Kläger nach der Aufstellung des Architekten Steuber vom 01.08.2011 (in Anlage K 20, AB) insgesamt 11.466,00 € netto, je Haus also 5.733,00 € netto entsprechend 6.822,27 € brutto verlangen, für die Bauleitung je Haus 3.120,00 € netto entsprechend 3.712,80 € brutto. Die statische Ertüchtigung des Gebäudes
muss geplant werden. Die Bauarbeiten mit Eingriffen in die Gebäudesubstanz können nicht von den Klägern selbst überwacht werden.
Die Kläger können die Kosten nach dem vorgesehenen Stundensatz von jeweils 78,00 € berechnen. Die Kosten müssen nicht nach der HOAI berechnet werden. Es geht nämlich um eine Sanierung eines bestehenden Gebäudes, deren Aufwand schwer abzuschätzen ist. Es hat seine Berechtigung, wenn Statiker und Architekt diese Aufgabe nur zu Stundenhonorar übernehmen wollen. Die Kläger verstoßen nicht gegen ihre Schadensminderungspflicht, wenn sie auf diese Forderung eingehen. Sie müssen die Leistungen für die Sanierung am Markt beschaffen und sind dabei nicht gehalten, im Interesse des Beklagten die Kosten besonders niedrig zu halten.
g) Für das Ausräumen, Einlagern und Einräumen der Möbel sind für das Haus der Kläger zu 1) und 2) 2.219,55 € netto entsprechend 2.641,26 € brutto nach dem Angebot der G1 Möbelspedition vom 28.03.2011 (Anlage K 21, AB) anzusetzen, für das Haus der Kläger zu 3) und 4) 2.051,73 € netto entsprechend 2.441,56 € brutto nach dem Angebot der G1 Möbelspedition vom 24.03.2011 (Anlage K 23, AB). Hinzu kommen Kosten für eine Ersatzunterkunft von 3.528,00 € brutto = netto je Haus (Anlage K 22, AB).
Die Häuser werden während der Sanierungsarbeiten nicht bewohnbar sein. Die Arbeiten machen Eingriffe in die Außenwände und die Decke notwendig, von denen jedes Zimmer im Obergeschoss betroffen ist. Durch das Auffräsen der Wände und das Aufstemmen des Estrichs wird es zu Staub- und Lärmbelastungen kommen.
h) Die genannten Beträge summieren sich auf 45.197,17 € brutto für die Kläger zu 1) und 2) und 47.494,26 € brutto für die Kläger zu 3) und 4).
Diese Beträge sind angemessen zu erhöhen, weil die ihnen zugrunde liegenden Angebote bereits mehr als sieben Jahre alt sind. Es ist allgemein bekannt, dass es seitdem gerade im Baubereich wegen der hohen Nachfrage zu Kostensteigerungen gekommen ist. Das ist dem Senat auch aus anderen Bausachen bekannt. Er schätzt die Preissteigerung auf mindestens 20 %. Mit diesem Zuschlag ergeben sich 53.784,63 € brutto für die Kläger zu 1) und 2) und 56.518,17 € brutto für die Kläger zu 3) und 4).
5. Die Entscheidung des Landgerichts über die Nebenansprüche bleibt bestehen.
a) Die Kläger zu 1) und 2) einerseits und zu 3) und 4) andererseits können aus §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB den Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Höhe von je
1.784,29 € verlangen. Der Beklagte ist vorgerichtlich mit Schreiben vom 18.07.2008 (Anlage K 13, AB) zur Zahlung aufgefordert worden.
Die Rechtsanwaltskosten bestimmen sich jedenfalls nach einem Gegenstandswert von 100.000,00 €. Die einfache Gebühr beträgt nach § 13 Abs. 1 RVG a. F. 1.354,00 €. Entstanden ist eine Geschäftsgebühr von 2,2 (1,3 zzgl. 0,9 für drei weitere Auftraggeber), also 2.978,80 € zzgl. Auslagenpauschale von 20,00 € und Umsatzsteuer von 569,77 €, zusammen 3.568,57 €. Davon entfällt auf jedes Haus die Hälfte.
b) Zinsen können die Kläger nach §§ 291, 288 Abs. 1 BGB geltend machen. Rechtshängigkeit ist durch Zustellung der Klage am 29.09.2011 (Bl. 17 d. A.) eingetreten.
Der Zinsanspruch läuft nicht erst ab der Ankündigung der Kläger, einen Vorschuss zu verlangen. Der Schadensersatzanspruch in der ausgeurteilten Höhe war vielmehr von Anfang an fällig. Nach wie vor machen die Kläger Schadensersatz geltend. Daran ändert es nichts, dass sie wegen einer neuen Rechtslage bereit sind, über den empfangenen Betrag abzurechnen.
6. Die Feststellungsanträge sind weiterhin zulässig, auch wenn sie bei einem Vorschuss an sich nicht notwendig sind, weil über ihn ohnehin abzurechnen ist und die Verurteilung bereits die Feststellung der Mängel und der Pflicht, weitere Kosten zu tragen, enthält. Die Feststellung hat daneben nur noch klarstellende Funktion.
Die Feststellungsanträge sind weiterhin begründet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Sanierungskosten wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten einerseits und Preissteigerungen andererseits höher ausfallen werden als geschätzt. Die genauen Kosten werden erst nach einer auch vom Sachverständigen für notwendig gehaltenen genauen Sanierungsplanung und nach einem örtlichen Aufmaß feststehen.
Der Tenor aber ist redaktionell zu ändern, weil sich die Feststellung nicht mehr auf die Umsatzsteuer bezieht. Vielmehr steht den Klägern als Vorschuss bereits ein Bruttobetrag zu.
Zu ändern ist der Tenor zudem, soweit auch die Risse im Erdgeschoss in die Feststellung aufgenommen worden sind. Denn diese hat der Beklagte, wie ausgeführt, nicht zu vertreten.
7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 709, 711 ZPO.
Für die erste Instanz verbleibt es bei der Kostenentscheidung des Landgerichts. Eine Veränderung zu Lasten des Beklagten als Berufungsführer kommt nicht infrage.
Die Zulassung der Revision ist nicht angezeigt, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich um eine Entscheidung im Einzelfall. Die entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind geklärt.
Soweit der Senat bei der Frage, wem Kostensteigerungen durch die Änderung von Normen zwischen der Abnahme und der Mangelbeseitigung zur Last fallen, von der Entscheidung des OLG Hamm abweicht, ist die Zulassung der Revision ebenfalls nicht angezeigt. Denn zum einen ist diese Entscheidung nicht näher begründet, zum anderen beschäftigt sie sich nicht mit der Haftung eines Statikers.