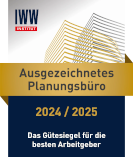02.02.2024 · IWW-Abrufnummer 239476
Landgericht Frankfurt a. M.: Urteil vom 26.06.2023 – 2-26 O 144/22
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Landgericht Frankfurt am Main
2-26 O 144/22
Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
- Kläger -
Prozessbevollmächtigter zu 1. und 2.:
Rechtsanwalt ………………………………………………….
gegen
………………………………………………………………………
- Beklagte -
Prozessbevollmächtigte:
………………………………………………………………..
hat das Landgericht Frankfurt am Main ‒ 26. Zivilkammer ‒ durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht …………. als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 01.06.2023 für Recht erkannt:
Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 23.102,13 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 12.12.2022 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch gegen die Kläger auf Zahlung von 11.284,26 € gemäß Rechnung vom 21.10.2022 (Rechnungsnummer RE0629) zusteht.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand:
Die Parteien schlossen am 13.6.2022 per Email einen Architektenvertrag betreffend den An- und Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Drei-Familienhaus in ………………(Anlage K 1 und K 2). Die Beklagte, die das Internetportal „………………“ betreibt, sollte u.a. die Ausführungsplanung erstellen und die Genehmigungsplanung des von den Klägern zuvor beauftragten Architekten …………………überarbeiten. Eine Widerrufsbelehrung seitens der Beklagten ist im Rahmen des Vertragsschlusses nicht erfolgt. Das Geschäftsverhältnis zu dem Architekten ………………..war von den Klägern durch Widerruf vom 15.6.2022 beendet worden.
In der Folge leisteten die Kläger drei Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 23.102,13 €. Eine vierte Abschlagsrechnung über 11.284,26 € zahlten sie nicht mehr, sondern erklärten den Widerruf des Vertrages mit der als Anlage K 7 vorgelegten Email vom 28.11.2022.
Mit der Klage verlangen sie nun die Rückzahlung der geleisteten Abschläge und begehren die Feststellung, dass der Beklagten kein Anspruch auf Zahlung der weiteren Abschlagsrechnung zusteht.
Die Kläger sind der Ansicht, aufgrund des erklärten Widerrufs habe sich das Vertragsverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt. Etwaige Ausnahmetatbestände lägen nicht vor. Insbesondere seien sie an der Ausübung des Widerrufsrechts auch nicht aus Gesichtspunkten von Treu und Glauben gehindert. Die von der Beklagten bis dato erstellte Planung sei nicht fertiggestellt und aufgrund von verschiedenen Mängeln unbrauchbar.
Die Kläger beantragen,
1. die Beklagte zu verurteilen, gemeinschaftlich an die Kläger 23.102,13 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit 07.12.2022 zu zahlen sowie
2. festzustellen, dass die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 11.282,26 Euro gemäß der am 21.10.2022 gestellten Rechnung RE0629 gegen die Kläger hat.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Ansicht, es liege der Ausnahmetatbestand des § 312c Abs. 1 BGB vor, weil sie normalerweise nicht über Fernkommunikationsmittel Verträge abschließe. Es handele sich hier um eine Ausnahme, da die Kläger bereits über Pläne ihres zuvor beauftragten Architekten verfügt hätten.
Darüber hinaus handele es sich um eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB, da die Kläger bei Vertragsschluss ihr Widerrufsrecht gekannt und bereits den zuvor geschlossenen Architektenvertrag mit dem Architekten …………ebenfalls widerrufen hätten. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handele und die Kläger die von der Beklagten erstellte Planung entgegengenommen und gegenüber der Bauaufsichtsbehörde verwertet hätten.
Jedenfalls bestehe eine Vergütungspflicht der Kläger aus § 357a Abs. 2 BGB, weil diese ausdrücklich verlangt hätten, dass mit der Leistungserbringung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist mit Ausnahme eines Teils des Zinsanspruchs begründet.
Die Kläger haben gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückzahlung des geleisteten Architektenhonorars in Höhe von 23.102,13 € sowie auf Feststellung des Nichtbestehens weiterer Ansprüche der Beklagten gemäß §§ 357 Abs. 1, 355 Abs. 1, Abs. 3 S.1, 312, 312c, 312g Abs. 1 BGB.
Gemäß § 355 Abs. 1 BGB sind Verbraucher und Unternehmer an die auf den Abschluss des Vertrages gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn dem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht zugestanden hat und die Willenserklärung durch diesen fristgerecht widerrufen wurde. Nach § 355 Abs. 3 S. 1 BGB sind die empfangenen Leistungen im Falle eines Widerrufs unverzüglich zurückzugewähren. Ferner regelt § 357 BGB die Rechtsfolgen des Widerrufs speziell bei Fernabsatzverträgen.
Die Kläger haben gegenüber der Beklagten mit Schreiben vom 28.11.2022 wirksam den Widerruf des Architektenvertrages erklärt. Eine Begründung war gemäß § 355 Abs. 4 BGB nicht erforderlich.
Den Klägern stand aus §§ 312, 312g Abs. 1, 312c Abs. 1, 2 BGB ein Widerrufsrecht zu, da zwischen den Parteien ein Fernabsatzvertrag geschlossen wurde.
Zunächst ist der persönliche Anwendungsbereich gem. § 312 Abs. 1 BGB eröffnet, nach welchem die Vorschriften der §§ 312 ff. BGB nur auf Verbraucherverträge anzuwenden sind. Die Kläger sind als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB anzusehen, die Beklagte ist Unternehmerin im Sinne des § 14 BGB. Dem steht auch nicht entgegen, dass der Kläger zu 2) selbst als Rechtsanwalt tätig ist und somit über rechtliche Kenntnisse verfügt. Denn auch eine als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin berufstätige Person ist grundsätzlich Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (vgl. BGH, NJW 2009, 3780). Die Kläger haben den Vertrag unstreitig nicht zu gewerblichen oder berufsbedingten Zwecken, sondern aus privaten Gründen geschlossen. Auch der Kläger zu 2) handelte nicht in Verfolgung seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
Ferner handelte es ich bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Architektenvertrag auch um einen Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312c BGB. Die Parteien haben für den Vertragsschluss ausschließlich per E-Mail und damit per Fernkommunikationsmittel kommuniziert.
Das Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge ergibt sich aus § 312 g Abs. 1 BGB, welcher für das Widerrufsrecht von Verbrauchern für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen auf § 355 BGB verweist.
Die Beklagte hat schon nicht substantiiert dargelegt, dass es sich bei ihrem Geschäftsmodell um kein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem handelt. Der Unternehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für den gesetzlich als Ausnahmetatbestand formulierten Fall des § 312c Abs. 1 BGB, dass der Vertrag nicht im Rahmen eines für den Fernabsatzvertrag organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt ist, wenn ausschließlich Fernkommunikationsmittel genutzt wurden.
Hinsichtlich des gesetzlich normierten Ausnahmetatbestandes hat die Beklagte lediglich pauschal behauptet, dass es sich bei dem Vertragsschluss mit den Klägern via E-Mail um eine Ausnahme gehandelt habe und die Verträge mit den Kunden normalerweise nicht mit Fernkommunikationsmitteln geschlossen würden, sodass es sich bei ihr nicht um ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem handele. Beweis hat sie für diese Behauptung nicht angeboten.
Die Kläger haben den streitgegenständlichen Architektenvertrag gegenüber der Beklagten auch fristgerecht widerrufen.
Aufgrund des wirksamen Widerrufs sind die Kläger nicht zur Zahlung von Architektenhonorar verpflichtet. Sie schulden auch keinen Wertersatz nach § 357a BGB. Voraussetzung hierfür ist, dass der Unternehmer den Verbraucher ordnungsgemäß nach Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 3 EGBGB über die Bedingungen, Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie über die Pflicht zur Zahlung eines angemessenen Betrags für den Fall des Widerrufs informiert hat. Diese Information muss dem Verbraucher erteilt worden sein, bevor dieser von dem Unternehmer die Ausführung der Dienstleistung verlangt. Da die Kläger nicht über ihr Widerrufsrecht belehrt wurden, scheidet ein Anspruch der Beklagten auf Wertersatz aus.
Die Ausübung des Widerrufsrechts der Kläger war entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 242 BGB. Allein die Tatsache, dass die Kläger kurz nach Abschluss des streitgegenständlichen Vertrages den Vertrag mit dem Architekten ……………widerriefen, genügt für die Annahme des Rechtsmissbrauchs auch im Zusammenspiel mit der Tatsache nicht, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handelt.
Denn an die Annahme eines rechtmissbräuchlichen Verhaltens beim Verbraucherwiderruf sind hohe Anforderungen zu stellen, weshalb dies nur in besonderen Ausnahmefällen angenommen werden kann, wenn sich das Unternehmen als besonders schutzbedürftig darstellt oder im Falle eines besonders arglistigen oder schikanösen Verhaltens des Verbrauchers (vgl. BGH, NJW 2016, 1951).
Von einem solchen Verhalten ist hier nicht auszugehen. Bei der Entscheidung, ob es sich um ein rechtmissbräuchliches Berufen auf eine Rechtsposition handelt, sind die Interessen aller an dem Rechtsverhältnis beteiligten Personen und die gesamten Umstände zu berücksichtigen (vgl. BGH, NJW 2021, 307).
Einem Verbraucher kann das Widerrufsrecht mit Berufung auf einen Rechtsmissbrauch nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil er auch in einem weiteren Vertragsverhältnis ein ihm gesetzlich zustehendes Widerrufsrecht ausgeübt hat. Umstände, die hier ein besonders rücksichtsloses oder gar arglistiges Verhalten der Kläger begründen könnten, sind nicht ersichtlich.
Auch der Umstand, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handelt, führt zu keinem anderen Ergebnis, da ansonsten der Verbraucherbegriff des § 13 BGB unangemessen eingeschränkt würde.
Dass die Kläger die von der Beklagten erbrachten Planungsleistungen dabei teilweise verwertet haben, steht einem Widerruf ebenfalls nicht entgegen. Sinn und Zweck des Widerrufs ist gerade, dass der Verbraucher an keine materiellen Voraussetzungen gebunden ist und er sich in einfacher Art und Weise sowie einseitig von einem Vertrag lösen kann. Eine Motivprüfung findet in diesen Fällen gerade nicht statt, vielmehr darf der Verbraucher das ihm eingeräumte Widerrufsrecht zu seinem Vorteil nutzen, wenn die Grenze der Arglist und Schikane nicht überschritten ist (vgl. BGH, NJW 2016, 1951). Als Ausgleich für bereits erbrachte Leistungen stellt das Gesetz dem Unternehmer grundsätzlich einen Anspruch auf Wertersatz nach § 357a BGB zur Verfügung. Damit wird dem Umstand hinreichend Rechnung getragen, dass der Unternehmer Vorleistungen erbracht hat. Die Voraussetzungen hierfür sind in § 357a BGB abschließend geregelt. Die Tatsache, dass ‒ wie im hier zu beurteilenden Fall ‒ die Voraussetzungen zur Zahlung von Wertersatz nicht vorliegen, führt noch nicht zur Rechtsmissbräuchlichkeit des erklärten Widerrufs.
Die empfangenen Leistungen sind bei einem wirksamen Widerruf gemäß § 355 Abs. 3 BGB zurückzugewähren. Vorliegend haben die Kläger an die Beklagte unstreitig insgesamt 23.102,13 € an Abschlagszahlungen geleistet.
Der Anspruch auf Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 357 Abs. 1, 286 Abs. 2 S.2, 288 Abs. 1 BGB. Die Vorschrift des § 357 Abs. 1 BGB stellt eine Spezialregelung zum Schuldnerverzug im Sinne eines automatischen Verzugseintritts mit Fristablauf dar. Aufgrund der Höchstfrist des § 357 Abs. 1 BGB von 14 Tagen hätten die Leistungen spätestens bis zum 11.12.2022 zurückgewährt werden müssen. Die Beklagte befand sich dementsprechend seit dem 12.12.2022 in Verzug. Soweit die Kläger Zinsen bereits ab dem 7.12.2022 verlangen, war die Klage im Übrigen abzuweisen.
Die Kläger können darüber hinaus die Feststellung verlangen, dass der Beklagten kein Anspruch auf weitere Zahlung zusteht. Das besondere negative Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO ist gegeben, nachdem die Beklagte die weitere Abschlagsrechnung vom 21.10.2022 gestellt hat und sich eines entsprechenden Vergütungsanspruchs berühmt.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs.2 Nr. 1 ZPO. Der Klage bleibt lediglich hinsichtlich des Zinslaufs teilweise der Erfolg versagt. Die Zuvielforderung fällt nicht ins Gewicht, sodass der Beklagten die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen waren.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.
2-26 O 144/22
Verkündet am: 26.06.2023
Im Namen des Volkes
U r t e i l
In dem Rechtsstreit
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
- Kläger -
Prozessbevollmächtigter zu 1. und 2.:
Rechtsanwalt ………………………………………………….
gegen
………………………………………………………………………
- Beklagte -
Prozessbevollmächtigte:
………………………………………………………………..
hat das Landgericht Frankfurt am Main ‒ 26. Zivilkammer ‒ durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht …………. als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 01.06.2023 für Recht erkannt:
Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 23.102,13 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 12.12.2022 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch gegen die Kläger auf Zahlung von 11.284,26 € gemäß Rechnung vom 21.10.2022 (Rechnungsnummer RE0629) zusteht.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand:
Die Parteien schlossen am 13.6.2022 per Email einen Architektenvertrag betreffend den An- und Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Drei-Familienhaus in ………………(Anlage K 1 und K 2). Die Beklagte, die das Internetportal „………………“ betreibt, sollte u.a. die Ausführungsplanung erstellen und die Genehmigungsplanung des von den Klägern zuvor beauftragten Architekten …………………überarbeiten. Eine Widerrufsbelehrung seitens der Beklagten ist im Rahmen des Vertragsschlusses nicht erfolgt. Das Geschäftsverhältnis zu dem Architekten ………………..war von den Klägern durch Widerruf vom 15.6.2022 beendet worden.
Die Leistungsphasen 1-4 wurden durch die Beklagte auf Stundenbasis abgerechnet.
Mit der Klage verlangen sie nun die Rückzahlung der geleisteten Abschläge und begehren die Feststellung, dass der Beklagten kein Anspruch auf Zahlung der weiteren Abschlagsrechnung zusteht.
Die Kläger sind der Ansicht, aufgrund des erklärten Widerrufs habe sich das Vertragsverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt. Etwaige Ausnahmetatbestände lägen nicht vor. Insbesondere seien sie an der Ausübung des Widerrufsrechts auch nicht aus Gesichtspunkten von Treu und Glauben gehindert. Die von der Beklagten bis dato erstellte Planung sei nicht fertiggestellt und aufgrund von verschiedenen Mängeln unbrauchbar.
Die Kläger beantragen,
1. die Beklagte zu verurteilen, gemeinschaftlich an die Kläger 23.102,13 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit 07.12.2022 zu zahlen sowie
2. festzustellen, dass die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 11.282,26 Euro gemäß der am 21.10.2022 gestellten Rechnung RE0629 gegen die Kläger hat.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Ansicht, es liege der Ausnahmetatbestand des § 312c Abs. 1 BGB vor, weil sie normalerweise nicht über Fernkommunikationsmittel Verträge abschließe. Es handele sich hier um eine Ausnahme, da die Kläger bereits über Pläne ihres zuvor beauftragten Architekten verfügt hätten.
Darüber hinaus handele es sich um eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB, da die Kläger bei Vertragsschluss ihr Widerrufsrecht gekannt und bereits den zuvor geschlossenen Architektenvertrag mit dem Architekten …………ebenfalls widerrufen hätten. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handele und die Kläger die von der Beklagten erstellte Planung entgegengenommen und gegenüber der Bauaufsichtsbehörde verwertet hätten.
Jedenfalls bestehe eine Vergütungspflicht der Kläger aus § 357a Abs. 2 BGB, weil diese ausdrücklich verlangt hätten, dass mit der Leistungserbringung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist mit Ausnahme eines Teils des Zinsanspruchs begründet.
Die Kläger haben gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückzahlung des geleisteten Architektenhonorars in Höhe von 23.102,13 € sowie auf Feststellung des Nichtbestehens weiterer Ansprüche der Beklagten gemäß §§ 357 Abs. 1, 355 Abs. 1, Abs. 3 S.1, 312, 312c, 312g Abs. 1 BGB.
Gemäß § 355 Abs. 1 BGB sind Verbraucher und Unternehmer an die auf den Abschluss des Vertrages gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn dem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht zugestanden hat und die Willenserklärung durch diesen fristgerecht widerrufen wurde. Nach § 355 Abs. 3 S. 1 BGB sind die empfangenen Leistungen im Falle eines Widerrufs unverzüglich zurückzugewähren. Ferner regelt § 357 BGB die Rechtsfolgen des Widerrufs speziell bei Fernabsatzverträgen.
Die Kläger haben gegenüber der Beklagten mit Schreiben vom 28.11.2022 wirksam den Widerruf des Architektenvertrages erklärt. Eine Begründung war gemäß § 355 Abs. 4 BGB nicht erforderlich.
Den Klägern stand aus §§ 312, 312g Abs. 1, 312c Abs. 1, 2 BGB ein Widerrufsrecht zu, da zwischen den Parteien ein Fernabsatzvertrag geschlossen wurde.
Zunächst ist der persönliche Anwendungsbereich gem. § 312 Abs. 1 BGB eröffnet, nach welchem die Vorschriften der §§ 312 ff. BGB nur auf Verbraucherverträge anzuwenden sind. Die Kläger sind als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB anzusehen, die Beklagte ist Unternehmerin im Sinne des § 14 BGB. Dem steht auch nicht entgegen, dass der Kläger zu 2) selbst als Rechtsanwalt tätig ist und somit über rechtliche Kenntnisse verfügt. Denn auch eine als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin berufstätige Person ist grundsätzlich Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (vgl. BGH, NJW 2009, 3780). Die Kläger haben den Vertrag unstreitig nicht zu gewerblichen oder berufsbedingten Zwecken, sondern aus privaten Gründen geschlossen. Auch der Kläger zu 2) handelte nicht in Verfolgung seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
Ferner handelte es ich bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Architektenvertrag auch um einen Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312c BGB. Die Parteien haben für den Vertragsschluss ausschließlich per E-Mail und damit per Fernkommunikationsmittel kommuniziert.
Das Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge ergibt sich aus § 312 g Abs. 1 BGB, welcher für das Widerrufsrecht von Verbrauchern für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen auf § 355 BGB verweist.
Die Beklagte hat schon nicht substantiiert dargelegt, dass es sich bei ihrem Geschäftsmodell um kein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem handelt. Der Unternehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für den gesetzlich als Ausnahmetatbestand formulierten Fall des § 312c Abs. 1 BGB, dass der Vertrag nicht im Rahmen eines für den Fernabsatzvertrag organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt ist, wenn ausschließlich Fernkommunikationsmittel genutzt wurden.
Hinsichtlich des gesetzlich normierten Ausnahmetatbestandes hat die Beklagte lediglich pauschal behauptet, dass es sich bei dem Vertragsschluss mit den Klägern via E-Mail um eine Ausnahme gehandelt habe und die Verträge mit den Kunden normalerweise nicht mit Fernkommunikationsmitteln geschlossen würden, sodass es sich bei ihr nicht um ein für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem handele. Beweis hat sie für diese Behauptung nicht angeboten.
Im Übrigen legen die von den Klägern mit Schriftsatz vom 31.3.2023 vorgelegten Screenshots der Homepage der Beklagten die gegenteilige Vermutung nahe. Insbesondere heißt es dort: „Sie kontaktieren das Team von ………….. über die Website oder telefonisch. Mithilfe Ihrer ersten Angaben können wir einschätzen, welcher unserer Partnerarchitekten für Sie in Frage kommt. (…) Bei einem Telefongespräch oder Videocall lernen Sie den vorgeschlagenen Architekten oder Fachplaner persönlich kennen. (…). Das Kennenlernen kann auf Wunsch auch am Ort des Bauvorhabens stattfinden.“ Dies unterstricht, dass das Geschäftsmodell der Beklagten geradezu auf den Abschluss der Verträge per Fernkommunikationsmittel ausgerichtet ist und ein persönliches Treffen die Ausnahme darstellt.
Für das Vorliegen des in § 312c Abs. 1 BGB geregelten Ausnahmetatbestandes ist mithin nichts ersichtlich.
Die Kläger haben den streitgegenständlichen Architektenvertrag gegenüber der Beklagten auch fristgerecht widerrufen.
Grundsätzlich beträgt die Widerrufsfrist bei Verbraucherverträgen gemäß § 355 Abs. 2 S. 1 BGB 14 Tage und beginnt gem. Abs. 2 S. 2 mit dem Vertragsschluss. Nach § 356 Abs. 3 S. 1, der das Widerrufsrecht für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge normiert, beginnt jedoch die Widerrufsfrist nicht zu laufen, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend den Anforderungen des Artikels 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bzw. 246b § 2 Abs. 1 des EGBGB unterrichtet hat. Vorliegend ist eine Widerrufsbelehrung vollständig unterblieben. Gemäß § 356 Abs. 3 S. 2 BGB erlischt das Widerrufsrecht spätestens 12 Monate und 14 Tage nach dem in Abs. 2 oder § 355 Abs. 2 S. 2 genannten Zeitpunkt.
Aufgrund des wirksamen Widerrufs sind die Kläger nicht zur Zahlung von Architektenhonorar verpflichtet. Sie schulden auch keinen Wertersatz nach § 357a BGB. Voraussetzung hierfür ist, dass der Unternehmer den Verbraucher ordnungsgemäß nach Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 3 EGBGB über die Bedingungen, Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie über die Pflicht zur Zahlung eines angemessenen Betrags für den Fall des Widerrufs informiert hat. Diese Information muss dem Verbraucher erteilt worden sein, bevor dieser von dem Unternehmer die Ausführung der Dienstleistung verlangt. Da die Kläger nicht über ihr Widerrufsrecht belehrt wurden, scheidet ein Anspruch der Beklagten auf Wertersatz aus.
Die Ausübung des Widerrufsrechts der Kläger war entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 242 BGB. Allein die Tatsache, dass die Kläger kurz nach Abschluss des streitgegenständlichen Vertrages den Vertrag mit dem Architekten ……………widerriefen, genügt für die Annahme des Rechtsmissbrauchs auch im Zusammenspiel mit der Tatsache nicht, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handelt.
Denn an die Annahme eines rechtmissbräuchlichen Verhaltens beim Verbraucherwiderruf sind hohe Anforderungen zu stellen, weshalb dies nur in besonderen Ausnahmefällen angenommen werden kann, wenn sich das Unternehmen als besonders schutzbedürftig darstellt oder im Falle eines besonders arglistigen oder schikanösen Verhaltens des Verbrauchers (vgl. BGH, NJW 2016, 1951).
Von einem solchen Verhalten ist hier nicht auszugehen. Bei der Entscheidung, ob es sich um ein rechtmissbräuchliches Berufen auf eine Rechtsposition handelt, sind die Interessen aller an dem Rechtsverhältnis beteiligten Personen und die gesamten Umstände zu berücksichtigen (vgl. BGH, NJW 2021, 307).
Einem Verbraucher kann das Widerrufsrecht mit Berufung auf einen Rechtsmissbrauch nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil er auch in einem weiteren Vertragsverhältnis ein ihm gesetzlich zustehendes Widerrufsrecht ausgeübt hat. Umstände, die hier ein besonders rücksichtsloses oder gar arglistiges Verhalten der Kläger begründen könnten, sind nicht ersichtlich.
Auch der Umstand, dass es sich bei dem Kläger zu 2) um einen Rechtsanwalt handelt, führt zu keinem anderen Ergebnis, da ansonsten der Verbraucherbegriff des § 13 BGB unangemessen eingeschränkt würde.
Dass die Kläger die von der Beklagten erbrachten Planungsleistungen dabei teilweise verwertet haben, steht einem Widerruf ebenfalls nicht entgegen. Sinn und Zweck des Widerrufs ist gerade, dass der Verbraucher an keine materiellen Voraussetzungen gebunden ist und er sich in einfacher Art und Weise sowie einseitig von einem Vertrag lösen kann. Eine Motivprüfung findet in diesen Fällen gerade nicht statt, vielmehr darf der Verbraucher das ihm eingeräumte Widerrufsrecht zu seinem Vorteil nutzen, wenn die Grenze der Arglist und Schikane nicht überschritten ist (vgl. BGH, NJW 2016, 1951). Als Ausgleich für bereits erbrachte Leistungen stellt das Gesetz dem Unternehmer grundsätzlich einen Anspruch auf Wertersatz nach § 357a BGB zur Verfügung. Damit wird dem Umstand hinreichend Rechnung getragen, dass der Unternehmer Vorleistungen erbracht hat. Die Voraussetzungen hierfür sind in § 357a BGB abschließend geregelt. Die Tatsache, dass ‒ wie im hier zu beurteilenden Fall ‒ die Voraussetzungen zur Zahlung von Wertersatz nicht vorliegen, führt noch nicht zur Rechtsmissbräuchlichkeit des erklärten Widerrufs.
Die empfangenen Leistungen sind bei einem wirksamen Widerruf gemäß § 355 Abs. 3 BGB zurückzugewähren. Vorliegend haben die Kläger an die Beklagte unstreitig insgesamt 23.102,13 € an Abschlagszahlungen geleistet.
Der Anspruch auf Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 357 Abs. 1, 286 Abs. 2 S.2, 288 Abs. 1 BGB. Die Vorschrift des § 357 Abs. 1 BGB stellt eine Spezialregelung zum Schuldnerverzug im Sinne eines automatischen Verzugseintritts mit Fristablauf dar. Aufgrund der Höchstfrist des § 357 Abs. 1 BGB von 14 Tagen hätten die Leistungen spätestens bis zum 11.12.2022 zurückgewährt werden müssen. Die Beklagte befand sich dementsprechend seit dem 12.12.2022 in Verzug. Soweit die Kläger Zinsen bereits ab dem 7.12.2022 verlangen, war die Klage im Übrigen abzuweisen.
Die Kläger können darüber hinaus die Feststellung verlangen, dass der Beklagten kein Anspruch auf weitere Zahlung zusteht. Das besondere negative Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO ist gegeben, nachdem die Beklagte die weitere Abschlagsrechnung vom 21.10.2022 gestellt hat und sich eines entsprechenden Vergütungsanspruchs berühmt.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs.2 Nr. 1 ZPO. Der Klage bleibt lediglich hinsichtlich des Zinslaufs teilweise der Erfolg versagt. Die Zuvielforderung fällt nicht ins Gewicht, sodass der Beklagten die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen waren.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.