· Ausland
Tätigkeiten und Mittelverwendung im Ausland: BayLfSt zu Anforderungen und Nachweisführung
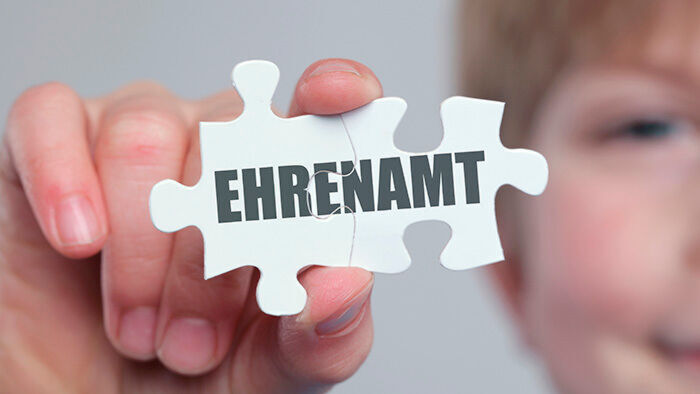

von Wolfgang Pfeffer, Drefahl
| Gemeinnützige Einrichtungen, die im Ausland tätig sind, gibt es recht viele. Bei der Mittelverwendung und der Mittelweitergabe gelten einige Besonderheiten, die SB auf Basis der jüngsten Stellungnahme der Finanzverwaltung, des Bayerischen Landesamts für Steuern (BayLfSt), nachfolgend für Sie aufbereitet und zusammenfasst. |
Verwirklichung steuerbegünstigter Tätigkeiten im Ausland
Grundsätzlich können steuerbegünstigte Zwecke auch im Ausland verwirklicht werden. Lediglich für die Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der Förderung des demokratischen Staatswesens und der Denkmalpflege haben Gesetzgeber bzw. Finanzverwaltung die Steuerbegünstigung auf Tätigkeiten im Inland beschränkt.
Eine Förderung der Allgemeinheit i. S. v. § 52 AO setzt nicht voraus, dass die Fördermaßnahmen Bewohnern oder Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland zugutekommen.
Das Kriterium „struktureller Inlandsbezug“
Erforderlich ist nur, dass natürliche Personen mit Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland gefördert werden, oder dass die Tätigkeit neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen kann (sog. Inlandsbezug → vgl. AEAO § 51 Abs. 2, Rz. 7). Bei inländischen Körperschaften ist zu unterstellen, dass dieser Inlandsbezug gegeben ist.
§ 51 Abs. 2 AO schränkt die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke im Ausland allerdings ein. Danach muss, sollen die gemeinnützigen Zwecke im Ausland verfolgt werden, für die Steuerbegünstigung eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Entweder müssen natürliche Personen gefördert werden, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, oder
- die Tätigkeit der begünstigten Einrichtung muss zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen können.
Dieser „strukturelle Inlandsbezug“ ist damit nach dem Wortlaut der Regelung eine zusätzliche Anforderung an die Gewährung der Gemeinnützigkeit. Betroffen ist grundsätzlich eine Vielzahl gemeinnütziger Einrichtungen, weil es hier nicht nur um im Ausland tätige Organisationen geht, sondern auch um die bloße Mittelweitergabe an ausländische Einrichtungen, etwa durch Förderstiftungen und -vereine. Auch direkte Spenden ins Ausland sind eingeschlossen.
Betroffen sein können grundsätzlich alle gemeinnützigen Zwecke, soweit die AO sie nicht ohnehin auf das Inland beschränkt (wie etwa bei der Förderung des demokratischen Staatswesens).
Diese Anforderungen stellt die Rechtsprechung an den Inlandsbezug
Der BFH hat die Anforderungen an den Inlandsbezug denkbar weit abgesenkt. Eine spürbare oder messbare Auswirkung auf das Ansehen Deutschlands ist nach seiner Auffassung nicht erforderlich. Nicht einmal eine nennenswerte Förderung oder Steigerung des Ansehens muss nachgewiesen werden. Es handele sich bei der Vorschrift des § 51 Abs. 2 AO auch nicht um einen eigenständigen Nebenzweck, der für die Gewährung der Gemeinnützigkeit erfüllt sein muss (BFH, Urteil vom 22.03.2018, Az. X R 5/16, Abruf-Nr. 202116).
Das sagt die Finanzverwaltung zum Inlandsbezug (und dessen Prüfung)
Die Finanzverwaltung scheint die Frage des strukturellen Inlandsbezugs nicht zu prüfen. Bei inländischen Körperschaften ‒ so die LfSt Bayern ‒ ist zu unterstellen, dass dieser Inlandsbezug gegeben ist (LfSt Bayern, Schreiben vom 14.08.2025, Az. S 0170.1.1-3/8 St31, Abruf-Nr. 249789).
Ausländische Organisationen
Auch ausländische Körperschaften können den Inlandsbezug erfüllen, wenn sie ihre steuerbegünstigten Zwecke zum Teil auch in Deutschland verwirklichen oder auch im Inland lebende natürliche Personen fördern. Hier geht die Finanzverwaltung aber anders als bei inländischen Körperschaften nicht stillschweigend davon aus, dass der strukturelle Inlandsbezug erfüllt ist.
Die Steuerbefreiung des § 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG gilt aber nur für beschränkt steuerpflichtige EU/EWR-Körperschaften i. S. v. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG.
Wichtig | Die Prüfung, ob diese Körperschaften steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, erfolgt anhand der gleichen Unterlagen, wie sie auch inländische Körperschaften vorlegen müssen. Die ausländische Körperschaft muss nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecken dienen. Der Nachweis, dass die ausländische Körperschaft die deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllt, muss sie durch Vorlage geeigneter Belege (Tätigkeitsberichte, Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben, Vermögensübersichten etc.) erbringen.
Die Mittelweitergabe an ausländische Organisationen
Neben der unmittelbaren Tätigkeit im Ausland ist auch eine Unterstützung ausländischer Organisationen durch die Weitergabe von Mitteln zulässig (§ 58 Nr. 1 AO). Voraussetzung ist, dass die Empfängerkörperschaft die Mittel für der Art nach steuerbegünstigte Zwecke verwendet und diese Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird.
Wichtig | Die Satzungszwecke von Mittelgeber und -empfänger müssen sich nicht decken. Voraussetzung ist aber, dass der Empfänger im Ausland einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des KStG entspricht.
Der anzustellende Rechtsformvergleich
Das LfSt Bayern verweist zu diesem Rechtsformvergleich auf das Schreiben des BMF (vom 24.12.1999, Az. IV B 4 ‒ S 1300 ‒ 111/99, Abruf-Nr. 130731). Dort sind im Anhang für eine Reihe von Ländern die dort gängigen Rechtsformen von Gesellschaften aufgelistet und den vergleichbaren deutschen Rechtsformen zugeordnet. Als Mittelempfänger kommen Gesellschaften infrage, die der deutschen GmbH, AG, e. G. oder einem Verein entsprechen. Um das zu prüfen, kann das Finanzamt die Satzung in deutscher Übersetzung anfordern.
Ist der Mittelempfänger eine Körperschaft mit Sitz in einem Land der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), genügt als Nachweis der Eintrag ins Zuwendungsempfängerregister. Für den Nachweis der satzungsmäßigen Mittelverwendung kann in diesen Fällen z. B. auch die ausgestellte Zuwendungsbestätigung dienen.
Es ist allerdings nicht Voraussetzung, dass die ausländische Körperschaft ‒ sofern sie keiner unbeschränkten oder beschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterliegt ‒ die Voraussetzungen des § 51 ff. AO erfüllt. Sollte aber die ausländische Körperschaft einer beschränkten Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG (EU-/EWR-Körperschaften) unterliegen, ist Voraussetzung für die Mittelweitergabe, dass die beschränkt steuerpflichtige Körperschaft selbst steuerbegünstigt ist. In der Praxis betrifft das alle privatrechtlichen Körperschaften.
Förderkörperschaften für ausländische Körperschaften
Die besondere Regelung für Förderkörperschaften in § 58 AO ist mit dem Jahressteuergesetz 2020 geändert worden. Für die Mittelweitergabe ins Ausland gelten hier keine besonderen Regelungen. Ist die Mittelweitergabe der alleinige Satzungszweck, muss das als Tätigkeit in der Satzung der Geberkörperschaft verankert sein.
Verfolgt die gemeinnützige Einrichtung eigene Satzungszwecke unmittelbar, ist auch bei der Mittelweitergabe ins Ausland eine spezielle Satzungsklausel zur Mittelweitergabe nicht erforderlich.
Einschaltung von Hilfspersonen im Ausland
Auch für Tätigkeiten im Ausland gelten die Regelungen zu Hilfspersonen nach § 57 Abs. 1 S. 2 AO. Das können auch ausländische natürliche oder juristische Personen sein. Die Finanzverwaltung verlangt hier aber entsprechende Nachweise, wie den Abschluss schriftlicher Verträge zwischen der steuerbegünstigten Körperschaft und der Hilfsperson, der Inhalt und Umfang der Tätigkeiten sowie die Rechenschaftspflichten der Hilfsperson festlegt. Abrechnungs- und Buchführungsunterlagen müssen in Deutschland aufbewahrt werden (§ 146 Abs. 2 AO).
Wichtig | Konkrete Vorgaben, welche vertragsrechtliche Form die Vereinbarungen mit Hilfspersonen haben müssen, machen Finanzverwaltung und Rechtsprechung nicht. Im AEAO wird die Vorlage entsprechender Vereinbarungen verlangt, die nachweisen, dass die gemeinnützige Körperschaft den Inhalt und den Umfang der Tätigkeit der Hilfsperson bestimmen kann.
Verwendungsnachweise korrekt erbringen
Unabhängig von der Form der Mittelweitergabe gelten für den Verwendungsnachweis im Ausland erhöhte Anforderungen (AEAO, Abs. 1 zu § 63 AO).
Finanzverwaltung akzeptiert Ausreden nicht
Einrichtungen können sich deswegen insbesondere nicht darauf berufen, dass sie die Mittelverwendung nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen können. Sie müssen die Tätigkeiten im Ausland entsprechend gestalten bzw. bei der Mittelweitergabe mit der ausländischen Körperschaft ausreichende Nachweispflichten vereinbaren.
Diese Unterlagen können das Nachweisproblem lösen
Das Finanzamt muss die zweckentsprechende Verwendung der Mittel prüfen können. Als Nachweise der satzungsmäßigen Mittelverwendung im Ausland können folgende Unterlagen dienen:
- Im Zusammenhang mit der Mittelverwendung abgeschlossene Verträge und entsprechende Vorgänge.
- Belege über den Abfluss der Mittel in das Ausland und Bestätigungen des Zahlungsempfängers über den Erhalt der Mittel.
- Ausführliche Tätigkeitsbeschreibungen der im Ausland entfalteten Aktivitäten und Material über die getätigten Projekte (z. B. Prospekte, Presseveröffentlichungen).
- Gutachten eines Wirtschaftsprüfers u. ä. bei großen oder andauernden Projekten.
- Bestätigungen einer deutschen Auslandsvertretung, dass die behaupteten Projekte durchgeführt werden.
Nach Lage und Bedeutung des Falls ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zu entscheiden, welche Nachweise gefordert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Körperschaften bei Auslandssachverhalten eine erhöhte Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflicht haben (§ 90 Abs. 2 AO). Das Finanzamt hat hier einen erheblichen Ermessensspielraum. Die Einrichtung sollte sich deswegen in jedem Fall vorab mit dem zuständigen Sachbearbeiter abstimmen.
FAZIT | Auch wenn Tätigkeiten im Ausland im Rahmen der Gemeinnützigkeit möglich sind, stellt der Nachweis der Mittelverwendung und der Steuerbegünstigung von Mittelempfängern spezielle Anforderungen. Gemeinnützige Einrichtungen sollten im Einzelfall mit dem Finanzamt Rücksprache halten, vor allem wenn die Tätigkeiten in einem EWR-Land erfolgen. |



















