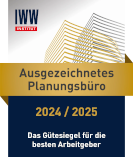01.02.2012 · IWW-Abrufnummer 120281
Oberlandesgericht Thüringen: Urteil vom 09.09.2010 – 1 U 887/07
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
OLG Thüringen
Urteil
Verkündet am: 09.09.2010
1 U 887/07
In dem Rechtsstreit
....
hat der 1. Zivilsenat des Thüringer Oberlandesgerichts in Jena durch
xxx
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29.07.2010
für Recht erkannt:
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts G vom 27.09.2007 - xxx - abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits fallen dem Kläger zur Last.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
5. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe:
I.
Der Kläger begehrt mit der vorliegenden Klage restliches Honorar aus dem mit der Beklagten am 21./30.01.1992 geschlossenen Ingenieurvertrag betreffend die Grundleistungen der technischen Ausrüstung des Um- und Neubaus des "Geronto-Psychiatrischen Pflegeheimes F K" in G (Anlage K1, Bl. 17 ff., Bd. I d.A.).
Nach den vertraglichen Vereinbarungen sollte über die Leistungsphasen 1.3 bis 1.6 und 1.8 (d.h. ab Entwurfsplanung) ein gesonderter Vertrag geschlossen werden (vgl. Vertragsbestätigungsschreiben der Beklagten vom 21.01.1992, Bl. 21, Bd. I d.A.).
Grundlagenermittlung und Vorplanung des Klägers sollten gemäß der ursprünglichen Vereinbarung bis zum 31.03.1992 erbracht sein.
Art und Umfang der vom Kläger zu erbringenden Leistungen waren u.a. in den am 25.01.1992 übergebenen Bauherrenanforderungen (Bl. 24, Bd. I d.A.) und den Antworten der Beklagten in dem ihr vom Kläger übersandten Fragebogen (Bl. 25 ff., Bd. I d.A.) beschrieben.
Ferner enthält das von einer Mitarbeiterin der Beklagten, der beim Landgericht G vernommenen Zeugin D---, gefertigte Protokoll über die Baubesprechung vom 10.03.1992 (Bl. 395 ff. Bd. III d.A.) Einzelheiten zu Planungsvorgaben (die allerdings im Einzelnen streitig sind).
Mit den Architektenleistungen für die Objektplanung beauftragte die Beklagte den Architekten B---. Aufgrund der engen Terminslage arbeiteten dieser und der Kläger zum Teil parallel.
Im Verlauf der Planungsarbeiten kam es zwischen den Parteien zu Meinungsverschiedenheiten über Grundlagen und Umfang der Planung. Während die Beklagte unstreitig eine Planung entsprechend den Vorgaben der Heimmindestverordnung forderte, wies das Objekt nach Auffassung des Klägers Krankenhauscharakter auf, weshalb er die Vorgaben der Krankenhausbauverordnung eingehalten wissen wollte (vgl. Niederschrift des Hochbauamts der Stadt G vom 03.03.1992 über die Beratung vom 27.02.1992, Bl. 150 ff., Bd. I d.A. sowie Niederschrift des Hochbauamts der Stadt G vom 22.04.1992 über die Beratung vom 21.04.1992, Bl. 152 f. Bd. I d.A. sowie vorläufige Studie des Klägers über die Planungsgrundlagen vom 30.01.1992, Bl. 242, Bd. II d.A.).
Über den Abschluss der Grundlagenermittlung legte der Kläger der Beklagten keinen schriftlichen Bericht vor.
In welchem Umfang nach Abschluss der Grundlagenermittlung und vor Abschluss der Vorplanung zwischen den Parteien Absprachen in Bezug auf den Ausstattungsgrad des geplanten Objektes sowie die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und damit auch für die Vorgaben der Beklagten insbesondere mit Bezug auf den finanziellen Rahmen für die Planung der technischen Ausrüstung getroffen bzw. von der Beklagten entsprechende Anweisungen erteilt wurden, ist zwischen den Parteien streitig.
Allerdings wurde noch vor Übergabe der Planungsunterlagen des Vorentwurfs für die Fachplanung des Klägers an die Beklagte am 15.04.1992 von der Beklagten der Ausstattungsgrad des geplanten Objekts präzisiert (vgl. Protokoll der Zeugin D--- von der Stadt G vom 18.03.1992 über die Besprechung vom 10.03.1992); der Inhalt der Vorgaben ist indes im Einzelnen streitig.
Zwischen dem Kl�äger als Fachplaner und dem Objektplaner, dem Zeugen B---, kam es ebenfalls zu Differenzen. Eine hinreichende Abstimmung zwischen Fachplanung und Objektplanung fand nicht statt, wobei umstritten ist, ob dies dem Kläger oder dem Zeugen B--- anzulasten und damit der Beklagten zuzurechnen ist.
Den ihr vom Kläger am 15.04.1992 übergebenen ersten Vorentwurf für die Fachplanung lehnte die Beklagte ab. Sie verlangte dessen Überarbeitung nach Maßgabe des Ergebnisses der Besprechung vom 21.04.1992 (vgl. Niederschrift des Hochbauamts der Stadt G vom 22.04.1992, Bl. 152 f., Bd. I d.A.). Nach dem Inhalt des Protokolls (die Planungsvorgaben der Beklagten sind allerdings, wie bereits ausgeführt, streitig) wurde insbesondere gefordert, nach den Vorgaben der Heimmindestbauverordnung zu planen, keine Wäscherei, sondern nur einen Waschmaschinenraum einzuplanen, nur eine Verteilerküche und keine "reguläre" Kochküche einzuordnen und eine Kostensenkung für die technische Ausrüstung von zur Zeit 12,7 Mio. DM auf 6,5 Mio. DM herbeizuführen (bei Gesamtbaukosten von max. 25 Mio. DM einschl. Baunebenkosten).
Den ihr am 29.04.1992 übergebenen, vom Kläger überarbeiteten Vorentwurf (Bl. 62 ff., Bd. I d.A.) lehnte die Beklagte ebenfalls ab (vgl. Schreiben der Beklagten vom 30.04.1992, Bl. 283, Bd. II d.A.), wobei sie darauf verwies, dass die Planung nicht den Vorgaben gemäß der Beratung vom 21.04.1992 entspreche und auch nicht mit dem Architekten, dem Zeugen B---, abgestimmt sei. Dem Kläger wurde eine Frist für die Vorlage einer "vertretbaren und umsetzbaren ökonomischen, mit dem Architekten abgestimmten Lösung" bis zum 29.05.1992 gesetzt.
Hierzu kam es aber nicht mehr.
Auch in der Folge konnte kein Einvernehmen über die Planung erzielt werden.
Vielmehr verhandelten die Parteien über die dem Kläger zu gewährende Entschädigung für die bis zum 30.04.1992 erbrachten Leistungen. Zur Diskussion standen u.a. eine Abschlagszahlung von 20.000 DM bei Weiterführung der Planung oder die Zahlung von 34.200 DM bei Beendigung des Vertragsverhältnisses (vgl. Schreiben der Beklagten vom 24.07.1992, Bl. 293, Bd. II d.A.).
Mit Schreiben vom 20.07.1992 (Bl. 292, Bd. II d.A.) verlangte der Kläger eine "Anarbeitungsentschädigung" für bisher entstandene Kosten als a-Konto-Forderung in Höhe von 34.200 DM, und mit Schreiben vom 30.07.1992 (Bl. 289 f., Bd. II d.A.) verlangte er die Zahlung einer finanziellen Abgeltung des Vorentwurfs mit mindestens 30 % bei Weiterführung der Objektplanung und Zusage eines gleich großen Planungsobjekts zu einem späteren Zeitpunkt. Eine Rechnung des Klägers vom 20.07.1992 über die a-Konto-Forderung von 34.200 DM (Anlage K16, Bl. 292 Bd. II d.A.) wies die Beklagte mit Schreiben vom 24.07.1992 (Anlage K17, Bl. 293 Bd. II d.A.) unter Hinweis auf eine behauptete Einigung über eine Abschlagszahlung von 20.000 DM für den Vorentwurf in der Besprechung vom 17.07.1992 zurück (vgl. Protokoll des Hochbauamts der Beklagten vom 20.07.1992 über die Besprechung vom 17.07.1992, welches vom Kläger in der vorgesehenen Unterschriftszeile nicht unterzeichnet ist, Bl. 287 f. Bd. II d.A.).
Nach weiterer Korrespondenz über die Frage einer Fortsetzung des Vertrags oder aber Vertragsbeendigung (bei einer Abgeltungszahlung von 34.200 DM) kündigte die Beklagte den Vertrag mit dem Kläger mit Schreiben vom 28.08.1992 (Bl. 53 f. Bd. I d.A.) mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund und kündigte die Überweisung von 34.200 DM an. Als Kündigungsgründe wurden mangelnde Abstimmung mit dem Architekten B--- und die Abweichung der Planung von den Forderungen der Beklagten als Auftraggeber genannt und darauf verwiesen, dass auch keine Einigung über das weitere Vorgehen erzielt werden konnte.
Der Kläger widersprach der Kündigung mit Schreiben vom 01.09.1992.
Mit Schreiben vom 23.09.1992 wies der Kläger auf sein Urheberrecht hinsichtlich der Planung hin und erklärte, die Beklagte dürfe diese Planung nicht verwenden, und sollte sie dies dennoch tun, werde das Gesamthonorar für die Planung fällig (vgl. Anlage K19, Bl. 295 Bd. II d.A.).
Mit Schlussrechnung vom 30.10.1992 (Bl. 58 ff. Bd. I d.A.) forderte der Kläger die Beklagte - unter Berücksichtigung einer bereits erbrachten a-Konto-Zahlung von 34.200 DM - zur Zahlung weiterer 198.348,95 DM auf.
Der Kläger ist der Ansicht, die abgerechneten Leistungen vertragsgerecht erbracht zu haben und Anspruch auf die geltend gemachte Vergütung zu haben. Er hat in Form einer Teilklage, deren Beträge sich aus den Ziffern 1, 2, 3, 4 und zum Teil 5 der Klageschrift zusammensetzen (Bl. 444, Bd. III d.A., 2 ff. Bd. I d.A.) beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an ihn 150.000 DM zzgl. 11 % Zinsen hieraus ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Ansicht, das geltend gemachte Honorar nicht zu schulden, weil die Kündigung gerechtfertigt und die vom Kläger erbrachte Vorplanung mangelhaft und für sie nicht verwertbar sei. Sie habe nicht ihren Planungsvorgaben entsprochen, insbesondere sei sie überdimensioniert und enthalte überflüssige Anlagen wie beispielsweise Notaufnahme, Pathologische Abteilung, doppelstöckige Kühlanlage, eine überdimensionierte geschlossene Abteilung und überdimensionierte Videoüberwachungsanlagen, eine Küche anstelle einer Verteilerküche und eine Wäscherei sowie überdimensionierte Liftanlagen. Der Kläger habe den ihm im März 1992 vorgegebenen Finanzrahmen bei seiner Planung nicht berücksichtigt. Zudem könne er keine Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Schwimmbad abrechnen, da diese Position bereits im März 1992, noch vor Übergabe der Vorplanung, ersatzlos gestrichen gewesen sei. Außerdem sei die Fachplanung des Klägers nicht mit der Objektplanung des Architekten B--- abgestimmt, was allein dem Kläger zuzurechnen sei.
Das Landgericht hat Sachverständigengutachten zur Frage der ordnungsgemäßen Erbringung der Planungsleistungen eingeholt. Wegen des Beweisergebnisses wird verwiesen auf das Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. P--- vom 09.05.1997 (Bl. 550 ff. Bd. IV d.A. nebst Ergänzungsgutachten vom 25.11.1997 (Bl. 597 ff. Bd. IV d.A.) sowie das Gutachten des Sachverständigen K--- vom 17.11.1997 (Bl. 603 ff. Bd. IV d.A.) nebst Ergänzungsgutachten vom 15.07.1998 (Bl. 703 ff. Bd. IV d.A.).
Das zunächst ergangene, der Klage in Höhe von 150.000 DM nebst 4 % Rechtshängigkeitszinsen stattgebende Urteil des Landgerichts G vom 21.12.1999, auf das verwiesen wird (Bl. 805 ff. Bd. IV d.A.), hat der Senat auf die Berufung der Beklagten mit Urteil vom 14.09.2000, auf dessen Entscheidungsgründe verwiesen wird (Bl. 51 ff. Bd. V d.A.), wegen unzureichender Sachaufklärung aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen.
Die Parteien haben dort ihr Vorbringen im Wesentlichen wiederholt und auch ihre Anträge wiederholt.
Das Landgericht hat eine weitere Sachaufklärung vorgenommen.
Die Zeugen B--- und D--- sind vernommen worden. Wegen des Beweisergebnisses wird auf die Sitzungsniederschrift des Landgerichts G vom 22.05.2001 (Bl. 139 ff. Bd. V d.A.) verwiesen. Auf die Vernehmung der übrigen Zeugen (H---, F--- und S---) hat die Beklagte verzichtet (vgl. Bl. 151 Bd. V d.A.).
Ferner hat das Landgericht G ergänzende Sachverständigengutachten eingeholt gemäß Beweisbeschluss vom 26.06.2001 (Bl. 163 ff. Bd. V d.A.) sowie Beschluss vom 14.09.2005 (Bl. 408 ff. Bd. VI d.A.).
Wegen des Beweisergebnisses wird insbesondere verwiesen auf Ergänzungsgutachten des Sachverständigen P--- vom 27.09.2004 und 19.07.2006 (jeweils gesondert geheftet), ferner Ergänzungsgutachten des Sachverständigen Hardt vom 13.12.2002 (Bl. 287 ff. Bd. VI d.A.) und vom 17.05.2005 (gesondert geheftet) sowie die gutachterlichen Stellungnahmen des Sachverständigen K--- vom 12.07.2002 (Bl. 224 ff. Bd. VI d.A.), vom 06.03.2007 (Bl. 492 ff. Bd. VII d.A.) und vom 14.06.2007 (Bl. 579 ff. Bd. VII d.A.) sowie das Protokoll über die Anhörung des Sachverständigen K--- vom 14.06.2007, Bl. 606 ff. Bd. VII d.A.
Im Übrigen wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen (§ 540 I S. 1 Nr. 1 ZPO).
Mit Urteil vom 27.09.2007 hat das Landgericht G die Beklagte unter Klageabweisung im Übrigen zur Zahlung von 66.960,58 Euro nebst Rechtshängigkeitszinsen verurteilt. Das Landgericht hat ausgeführt, dem Kläger stehe ein Honorar für die Vorplanung zu, hingegen mangels schriftlicher Niederlegung (welche für die Beklagte wegen des Abstimmungserfordernisses von besonderem Interesse gewesen wäre) kein Anspruch auf Vergütung für die Grundlagenermittlung.
Der Auffassung des Landgerichts zufolge ist das Honorar für die Vorplanung auch nicht zu reduzieren, weil sich die letzte Kostenschätzung ebenso im Rahmen der Toleranzen gehalten habe wie die Schlussrechnung, die auf anrechenbaren Kosten in Höhe von 6.966.501,48 Euro basiere. Angesichts der besonderen Problematik des streitgegenständlichen Bauvorhabens (Umbausituation bei einem Teil der Gebäude) sei ein Toleranzrahmen von 30 bis 40 % zuzubilligen. Die Planung sei auch nicht wegen Ausrichtung an der Krankenhausbauverordnung mangelhaft, weil die Frage der Ausrichtung an der Heimmindestbauverordnung oder der Krankenhausbauverordnung erst bei der Entwurfsplanung relevant werde. Es sei auch keine Reduzierung des Honorars wegen Planung u.a. einer eigenen Wäscherei und einer Kochküche sowie beheizter Dacheinläufe und eines Regelwassersammelbeckens vorzunehmen, weil die letzte Kostenschätzung sich unter Zugrundelegung des umbauten Raumes auf lediglich 7,5 Mio. DM belaufen habe, was das in Rechnung gestellte Honorar rechtfertige. Dem Kläger könne schließlich auch keine mangelhafte Abstimmung mit dem Architekten B--- zur Last gelegt werden. Dieser Umstand sei dem Kläger nicht zuzurechnen, weil beide ihre Planung parallel erarbeitet hätten und die Architektenpläne erst im Mai 1992 vorgelegen hätten. Ebenfalls zu vergüten seien die Honoraranteile für Stark- und Schwachstrom sowie Fördertechnik.
Allerdings hat nach Ansicht des Landgerichts ein Abschlag von 15 % des Honorars entsprechend der Regelung des Einigungsvertrags nach Maßgabe von § 6 Ziffer 1 Nr. 1 der Zusatzvereinbarung der Parteien zu erfolgen.
Wegen Einzelheiten der Begründung wird auf die Entscheidungsgründe des erstinstanzlichen Urteils vom 27.09.2007, Bl. 630 ff., 654 ff. Bd. VII d.A., verwiesen.
Gegen dieses Urteil haben beide Parteien form- und fristgerecht Berufungen eingelegt und begründet.
Der Kläger greift mit seiner Berufung die Vornahme des Abschlags von 15 % des Honorars nach den Festlegungen des Einigungsvertrags an und macht hierzu geltend, die Voraussetzungen für die Vornahme des Abschlags seien nicht erfüllt, da sich sein Geschäftssitz bei Vertragsschluss nicht im Beitrittsgebiet, sondern in E-L in Nordrhein-Westfalen befunden und er über keinen anderen Geschäftssitz verfügt habe, darüber hinaus sämtliche Leistungen am Geschäftssitz in Erftstadt erbracht worden seien und auch die gesamte Korrespondenz unter dieser Anschrift geführt worden sei.
Der Kläger beantragt,
das Urteil des Landgerichts G vom 25.09.2007 abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an ihn insgesamt 76.693,78 Euro (also weitere 9.733,20 Euro) nebst Rechtshängigkeitszinsen zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung des Klägers zurückzuweisen.
Die Beklagte hält die Vornahme des Abschlags von 15 % des Honorars für berechtigt und verweist hierzu auf ihr Auftragsschreiben vom 07.01.1992 unter § 6, Vergütung, wonach ein Abschlag von 15 % vereinbart sei. Darüber hinaus spreche auch die Regelung in § 7 des Ingenieurvertrags vom 30.01.1992, wonach für Nebenkosten die Berechnung der "Kosten von Apolda" vereinbart sei, für die Vornahme des Abschlags.
Die Beklagte erstrebt mit ihrer Berufung die Klageabweisung und macht hierzu insbesondere geltend:
Entgegen der Ansicht des Landgerichts sei eine Vergütung für die vom Kläger erbrachte Vorplanung für Fachgewerke nicht geschuldet. Denn diese Vorplanung sei für die Beklagte unbrauchbar. Die Planung entspreche nicht ihren Planungsvorgaben, insbesondere orientiere sie sich an den Vorgaben der Krankenhausbauverordnung anstatt an den Vorgaben der Heimmindestbauverordnung und enthalte kostenintensive, nicht notwendige und nicht zu planende Einrichtungen, und sie halte den vorgegebenen Kostenrahmen (von 6,5 Mio. DM für die Technikausrüstung) nicht ein. Außerdem sei sie nicht mit der Planung des Architekten B--- abgestimmt. Die fehlende Abstimmung der Fachplanung mit der Planung des Architekten B--- sei hierbei, entgegen der Ansicht des Landgerichts, dem Kläger zuzurechnen, da sich der Architekt, der Zeuge B---, im Gegensatz zum Kläger um eine Koordinierung bemüht habe, wie sich aus dessen Angaben bei der Zeugenvernehmung ergebe. Im Übrigen hätten auch die Zeitvorgaben der Beklagten eine Koordinierung zwischen beiden Planern in ausreichendem Umfang ermöglicht.
Das Landgericht habe es verabsäumt, die vertraglichen Grundlagen, insbesondere die Planungsvorgaben der Beklagten hinreichend aufzuklären und bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Die Frage der Ausrichtung der Planung an den Vorgaben der Beklagten hätten der vom Landgericht beauftragte Sachverständige K--- wie auch das Landgericht außer Acht gelassen, obwohl das Gericht ursprünglich (vgl. Beweisbeschluss vom 14.09.2005, Bl. 408 ff. Bd. VI d.A.) die Einhaltung der Planungsvorgaben für wesentlich erachtet habe. Der Sachverständige habe letztlich nur eine schematische und rein rechnerische Überprüfung der Honorarrechnung vorgenommen, und das Landgericht sei ihm hierin gefolgt.
Des Weiteren sei die Beweisverwertung des Landgerichts fehlerhaft. Der Grundsatz der Beweisunmittelbarkeit sei verletzt, weil das erkennende Gericht die Zeugenvernehmung nicht selbst durchgeführt habe, und die Beweiswürdigung sei nicht ordnungsgemäß und unvollständig, insbesondere habe das Gericht die Angaben des Zeugen B--- bei der Entscheidung unbeachtet gelassen.
Schließlich müsse die Klage auch deshalb abgewiesen werden, weil das Honorar mangels Erstellung einer prüffähigen Rechnung nicht fällig sei.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts G vom 27.09.2007 abzuändern und die Klage abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Der Kläger verteidigt das Urteil des Landgerichts als richtig, soweit der Klage stattgegeben worden ist. Er ist der Auffassung, das Landgericht habe die Frage der Mangelhaftigkeit der Planung, insbesondere der Beachtung von Planungsvorgaben der Beklagten wie auch der Koordinierung der Fachplanung zwischen beiden Planern hinreichend aufgeklärt. Im Übrigen habe der Beklagte, wie das Landgericht richtig festgestellt habe, seine Koordinierungspflicht hinreichend erfüllt; bis zur Vorlage der Fachplanung habe es noch nicht einmal eine ausreichende Architektenplanung gegeben, an der er sich hätte ausrichten können. Die Beweisaufnahme wie auch die Beweiswürdigung des Landgerichts seien nicht zu beanstanden.
Der Senat hat mit Beschluss vom 29.01.2009 (Bl. 772 ff. Bd. VIII d.A.), auf dessen Inhalt verwiesen wird, zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage Hinweise gegeben und die wiederholte Vernehmung des Zeugen B--- (zur Frage der Dimensionierung der Planung wie auch der Abstimmung zwischen Hauptplanung und Fachplanung) angeordnet.
Wegen des Ergebnisses der Zeugenvernehmung wird auf das Sitzungsprotokoll vom 02.07.2009 (Bl. 791 ff. Bd. VIII d.A.) verwiesen.
Auf den Hinweis des Senats mit Beschluss vom 29.01.2009 hat der Kläger geltend gemacht, dass seiner Ansicht zufolge eine Kostenobergrenze für die Technikausrüstung von 6,5 Mio. DM nicht vereinbart sei, dass es eine entsprechende Vorgabe selbst der Aussage des Zeugen B--- zufolge erstmals im Gespräch am 10.03.1992 gegeben habe, des weiteren der Aktenvermerk der Beklagten vom 18.03.1992 über die zuvor stattgefundene Besprechung am 10.03.1992 noch Gesamtbaukosten von ca. 20 bis 25 Mio. DM, also keine feste Obergrenze ausweise, sowie ferner, dass der Kläger auch eine feste Kostengrenze von 6,5 Mio. DM nicht im zivilprozessualen Sinne zugestanden habe und schließlich, dass die von ihm erstellte, zuletzt vorgelegte Planung im Rahmen der Toleranz liege.
Mit Beschluss vom 30.07.2009 (Bl. 799 ff. Bd. VIII d.A.), auf den verwiesen wird, hat der Senat die Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens zur Frage angeordnet, ob der Kläger bei seiner Planung die Planungsvorgaben der Beklagten hinsichtlich der Ausrichtung und der Dimensionierung der Planung eingehalten und berücksichtigt hat und welche Kosten für die technische Ausrüstung die vorgelegte Planung beinhaltet. Mit Beschluss vom 30.10.2009 hat der Senat die Sachverständige D- P--- mit der Begutachtung beauftragt, da die Erstellung des Gutachtens durch den erstinstanzlich tätigen Sachverständigen K--- nicht in Frage kam, nachdem dieser verstorben war.
Wegen des Ergebnisses der Begutachtung wird auf das schriftliche Sachverständigengutachten der Sachverständigen D- P--- vom 28.04.2010 (gesondert geheftet) sowie das Protokoll über die Anhörung der Sachverständigen D- P--- in der Sitzung vom 29.07.2010 (Bl. 890 ff. Bd. IX d.A.) verwiesen.
II.
1.
Die Berufung des Klägers ist - unabhängig davon, ob seine Leistungen zu vergüten sind (hierzu unter 2.) - nicht begründet.
Wie der Senat bereits mit Beschluss vom 29.01.2009 (unter I.1.) ausgeführt hat, hat das Landgericht zu Recht einen Gebührenabschlag von 15 % vorgenommen.
1.1.
Zum einen hatten die Parteien zunächst ausdrücklich ein Honorar "nach Maßgabe der Bestimmungen des Einigungsvertrags", d.h. in reduzierter Höhe vereinbart (vgl. Auftragsschreiben der Stadt G vom 07.01.1992, Anlage K28, Bl. 439 f. Bd. III d.A., für die Erarbeitung der Studie). Für den Folgevertrag vom 21.01./30.01.1992 haben die Parteien vereinbart, dass die Vergütung "unter Berücksichtigung der Festlegungen des Einigungsvertrages" erfolgt (vgl. Anlage K1, Bl. 20, 23 Bd. I d.A., Auftragsschreiben vom 21.01.1992).
Der Inhalt des von der Beklagten vorgelegten, vom Kläger selbst erstellten Aktenvermerks über die Vertragsverhandlung vom 16.01.1992 (hier: Verhandlung über die Vergütung, zu § 6,: "...minus 15 %.....", Bl. 752 Bd. VIII d.A.), dessen inhaltliche Richtigkeit der Kläger nicht bestreitet, spricht dafür, dass die Parteien mit dieser Formulierung zum Ausdruck bringen und vereinbaren wollten, dass ein Abschlag von 15 % vorzunehmen ist. Auch die Vereinbarung über die Abrechnung der Nebenkosten - Fahrtkosten von Apolda aus (vgl. § 7 des Auftragsschreibens der Beklagten vom 21.01.1992, Bl. 22 f. Bd. I d.A.) - spricht für die ausdrückliche Vereinbarung der Vornahme eines Honorarabschlags von 15 %.
1.2.
Darüber hinaus sind die Voraussetzungen für die Vornahme eines Abschlags in Höhe von 15 % des Honorars gemäß Anlage 1, Kapitel V, Sachgebiet A, Abschnitt 3 Nr. 2 und 3 des Einigungsvertrags vorliegend erfüllt, weshalb ohnehin ein Honorarabschlag vorzunehmen ist.
Dabei kommt es (worauf der Senat bereits hingewiesen hat) nicht darauf an, ob der Kläger seine Planungsleistung tatsächlich im Beitrittsgebiet erstellt hat oder nicht; ebenso wenig ist die personelle Besetzung seines Büros in Apolda (bzw. später Mellingen) von Relevanz.
Nach höchstrichterlicher Rechtssprechung (vgl. BGH, Urteil vom 18.09.1997, VII ZR 300/96, BGHZ 136, 342 ff.), der der Senat folgt, ist die Regelung des Einigungsvertrags in Anlage 1, Kapitel V, Sachgebiet A, Abschnitt 3, Nr. 2 und 3, wonach ein Abschlag in Höhe von 15 % zu erfolgen hat, schon dann anwendbar, wenn ein Architekt von einer im Geschäftsverkehr als Niederlassung auftretenden Einheit aus Verträge über Objekte im Beitrittsgebiet schließt.
Dies ist vorliegend gegeben.
Ausweislich des vom Kläger bei der Korrespondenz mit der Beklagten verwendeten Briefkopfes (vgl. Anlage K5, Bl. 33 f. sowie Bl. 37 Bd. I d.A.) führte der Kläger ein "Büro West" in E-L, hatte daneben aber auch ein "Kontaktbüro Thüringen" in Apolda beziehungsweise später (vgl. Anlage K15, Bl. 56 Bd. I d.A. und Anlage K19, Bl. 61 Bd. I d.A.) in Mellingen. Auch in der vom Kläger erstellen Planungsunterlage ist neben dem "Hauptbüro" Erftstadt ein "Zweigbüro" Apolda aufgeführt (vgl. Anlage K4, Bl. 62 Bd. I d.A.).
Für die Frage, ob die Abschlagsregelung anzuwenden ist, kommt es (wie ausgeführt) nicht darauf an, wo die Planungsleistungen tatsächlich erbracht sind, sondern maßgeblich ist die Art der Erbringung der Werkleistung im Außenverhältnis, also dass der Architektenvertrag von der Niederlassung in Apolda aus geschlossen ist.
Dies ist der Fall. Der Kläger hat nämlich, wie dargestellt, seine Niederlassung in Thüringen im Geschäftsverkehr mit der Beklagten geführt. Der Vertragspartner eines Architekten muss sich jedoch darauf einrichten können, dass ein im Geschäftsverkehr als Niederlassung geführtes Architekturbüro auch eine Niederlassung im honorarrechtlichen Sinne ist (vgl. BGH, Urteil vom 18.09.1997, VII ZR 300/96).
Die Frage, unter welcher Adresse die Beklagte ihre Schreiben an den Kläger gerichtet hat (nämlich an das Büro in Erftstadt) und wo der Kläger den Vertrag unterzeichnet hat (ebenfalls in Erftstadt), ist demgegenüber von untergeordneter Bedeutung. Denn auch wenn der Kläger vornehmlich über sein Hauptbüro in Erftstadt zu erreichen bzw. anzusprechen war (wofür die Korrespondenz unter dieser Adresse spricht), blieb daneben das Kontaktbüro in Thüringen, über welches ebenfalls hätte korrespondiert werden können. Dass aber im Vertragsverhältnis zwischen Kläger und Beklagter das Büro in Apolda/Thüringen maßgeblich war, ergibt sich schon aus der bereits erwähnten Regelung betreffend die Nebenkosten, wonach Kilometerkosten ab Apolda berechnet werden (vgl. Auftragsschreiben der Beklagten vom 21.01.1992, Bl. 22 f. I d.A., zu § 7 des Vertrags).
2.
Die Berufung der Beklagten ist begründet. Dem Kläger steht der ihm vom Landgericht zuerkannte Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) nicht zu.
2.1.
Zwar ist ein Vergütungsanspruch nicht bereits aufgrund eines Vergleichs mit Zahlung der 34.200 DM ausgeschlossen, da ein solcher Vergleich nicht zustande gekommen ist.
Auch dringt die Beklagte mit ihrem Einwand der fehlenden Prüffähigkeit der Schlussrechnung vom 30.10.1992 (Anlage K15, Bl. 56 ff. Bd. I d.A.) nicht durch.
Die Schlussrechnung enthält eine Zusammenstellung der anrechenbaren Kosten, ferner die Honorarzone, den Honoraransatz und die Grundlagen der einzelnen Leistungsphasen, insbesondere die Honorarbezugssumme (gemäß DIN 276), und zwar aufgegliedert nach Anlagengruppen und differenziert nach Maßnahmen im Neubau und im Altbau (wegen des Umbauzuschlags). Beigefügt sind zudem eine Aufgliederung der Gesamtkosten Technik in Alt- und Neubaumaßnahme (Anlage K16, Bl. 58 Bd. I d.A.) sowie eine Kostenaufstellung nach Netto-Investitionssumme und Prozent-Anteil je Fachwerk (K17, Bl. 59 Bd. I d.A.).
Eine Prüffähigkeit ist jedenfalls mit Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen K--- vom 25.11.1997 (Bl. 597 ff. Bd. IV d.A.) eingetreten, mit welchem eine Prüfung der Schlussrechnung erfolgt ist (vgl. Bl. 616 f. Bd. IV d.A.).
Soweit aber die Berechnung des Honorars in der Schlussrechnung des Klägers auf anrechenbaren Kosten gemäß Kostenschätzung in Höhe von 6.966.501,37 DM netto basiert und die Beklagte moniert, dass die Nettoinvestitionskosten in dieser Höhe nicht zugrunde gelegt werden dürften, ist dies eine Frage der sachlichen Richtigkeit, nicht aber der Prüffähigkeit der Rechnung.
2.2.
Die Beklagte schuldet keine Vergütung für die vom Kläger erstellte Vorplanung, weil diese den Architektenvertrag berechtigt und wirksam aus wichtigem Grund gekündigt hat und darüber hinaus die Vorplanung nicht mangelfrei erbracht und für die Beklagte unbrauchbar ist.
Zwar steht dem Architekten nach berechtigter Kündigung aus wichtigem Grund grundsätzlich ein Anspruch auf Vergütung seiner bis dahin erbrachten Leistungen zu.
Eine Vergütung ist allerdings nach höchstrichterlicher Rechtssprechung, der der Senat folgt, nicht geschuldet, wenn das Architektenwerk schwerwiegende Mängel aufweist und für den Auftraggeber wertlos ist. Ein solcher Mangel kann beispielsweise darin liegen, dass der Architekt seine Planung nicht nach den vertraglichen Vorgaben des Bauherrn ausrichtet und der Auftraggeber deshalb gehalten ist, nach Kündigung eine neue Planung erstellen zu lassen (BGH, Urteil vom 05.06.1997, VII ZR 124/96, Rdnr. 23 bei juris-online, ebenfalls veröffentlicht in: BGHZ 136, 33 - 40 und NJW 1997, 3017 f.).
So liegt der Fall hier, und zwar unabhängig davon, ob darüber hinaus eine Verwertbarkeit der Fachplanung des Klägers auch wegen fehlender Abstimmung mit dem Hauptarchitekten, dem Zeugen B---, nicht oder nur eingeschränkt gegeben war.
2.3.
Die Planung des Klägers ist bereits insoweit mangelhaft, als sie sich nicht, den Vorgaben der Beklagten entsprechend, an den Vorschriften der Heimmindestbauverordnung, sondern an den Vorgaben der Krankenhausbauverordnung ausrichtete und darüber hinaus weitere Bauherrenwünsche, vor allem den Verzicht auf kostenintensive Einrichtungen wie beispielsweise Gro�ßwäscherei, Pathologieraum, Notaufnahme unbeachtet gelassen hat. Darüber hinaus ist der vom Bauherrn vorgegebene Kostenrahmen nicht eingehalten.
Dabei ist unerheblich, ob die vorgenannten Planungsvorgaben der Beklagten mit Bezug auf die Ausrichtung und Dimensionierung der Planung wie auch die Vorgabe einer einzuhaltenden Kostenobergrenze für die Technikausrüstung bereits bei Vertragsschluss oder später gemacht wurden.
Vorgaben des Bauherrn sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, an der sich der Senat ausrichtet, auch dann verbindlich, wenn sie erst im Laufe des Planungsprozesses gemacht werden (BGH, Urteil vom 22.01.1998, VII ZR 259/96, abgedruckt in BGHZ 138, 87 ff.).
Denn die vorliegende Planung eines Pflegeheimes ist eine komplexe Aufgabe, und welche Ziele dabei vorrangig zu berücksichtigen sind, hat nicht der Architekt bzw. Fachplaner zu entscheiden, er hat vielmehr die Ziele des Bauherrn zu verwirklichen.
Dem ist der Kläger nicht nachgekommen.
2.4.
Zu der gewünschten Ausrichtung und Dimensionierung der Planung hat der Senat folgende Feststellungen getroffen:
Bereits aus der vom Kläger am 25.01.1992 überreichten Aufgabenstellung (erstellt vom Amt für Heimpflege G, K2, Bl. 24 Bd. I d.A.), ergibt sich, dass sich die Planung an der Heimmindestbauverordnung orientieren sollte; dies ist überdies unstreitig.
Darüber hinaus hat der Zeuge B--- sowohl bei seiner landgerichtlichen Vernehmung am 22.05.2001 (dort S. 7, Bl. 139 ff., 145 Bd. V d.A.) als auch bei seiner Vernehmung vor dem Senat am 02.07.2009 (Bl. 791 ff. Bd. VIII d.A.) glaubhaft erklärt, dass in einem Gespräch vom 10.03.1992, bei dem auch der Kläger anwesend gewesen sei (wie er dies auch bei den übrigen Besprechungen gewesen sei) seitens der Beklagten weitere verbindliche Vorgaben gemacht wurden, die insbesondere dahin gingen, dass keine Großwäscherei (sondern nur ein Raum mit Waschmaschinen zur Selbstnutzung) und keine Zubereitungs- bzw. Kochküche (sondern eine Verteilerküche) geplant werden sollten. Seinen Angaben in der Zeugenvernehmung vom 02.07.2009 zufolge sollte ferner auf einen Leichenraum verzichtet werden, und für ein Schwimmbad sollten nur Anschlusswerte geplant werden.
Der Senat hält die Angaben des Zeugen B--- für glaubhaft. An seiner Glaubwürdigkeit zu zweifeln gibt es keinen Anlass, und er hat bei seiner Vernehmung vor dem Senat auch trotz seines fortgeschrittenen Alters ein gutes Erinnerungsvermögen gezeigt, denn er hat zahlreiche Einzelheiten geschildert, die mit dem Inhalt der von Mitarbeitern der Beklagten gefertigten Besprechungsprotokolle übereinstimmen.
Soweit der Zeuge die Leistungen des Klägers in seiner Vernehmung als überdimensioniert gekennzeichnet und geschildert hat, dass der Kläger immer wieder seine (des Zeugen B---) Planung "negiert" habe, ihn nicht hinreichend einbezogen und hinzugezogen habe und sogar habe erkennen lassen, dass man gegenüber der Beklagten ruhig "ordentlich abrechnen" könne (vgl. S. 4 des Vernehmungsprotokolls vom 02.07.2009), "belastet" dies zwar den Kläger, gibt aber keinen hinreichenden Anlass zu der Annahme, dass die Angaben des Zeugen B--- unwahr und nur von Belastungstendenzen bestimmt sind. Für die Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen sprechen die vorliegenden schriftlichen Unterlagen (hierzu im nachfolgenden Absatz), die die Richtigkeit seiner Angaben untermauern, und zwar insbesondere die von Mitarbeitern der Beklagten gefertigten Protokolle über Besprechungen, vor allem diejenige vom 10.03.1992. Dass es weitgehende Übereinstimmungen zwischen der Zeugenaussage und dem Inhalt der Besprechungsprotokolle gibt, weil der Zeuge zur Vorbereitung seiner Aussagen die Besprechungsprotokolle eingesehen und sich hieran orientiert hätte, kommt nach Ansicht des Senats nicht in Frage, da der Zeuge glaubhaft versichert hat, über keine Akten mehr zu verfügen, weil er diese anlässlich eines Umzugs aussortiert habe (vgl. S. 4 des Sitzungsprotokolls vom 02.07.2009).
Aus der Niederschrift des Hochbauamts G vom 18.03.1992 über die (vom Zeugen B--- angesprochene) Beratung am 10.03.1992 (K20, Bl. 368 ff. Bd. II d.A. sowie Bl. 395 ff. Bd. III d.A.) geht hervor, dass die Küche ausgelagert und statt dessen nur eine Speisenverteilungsküche eingeplant werden sollte, ferner, dass es keine Wäscherei für die Weißwäsche geben sollte, darüber hinaus auch, dass die Gesamtbaukosten nur 20 bis 25 Mio. DM (25 Mio. DM einschl. Baunebenkosten) betragen sollten. Der Niederschrift des Hochbauamts G vom 22.04.1992 über die Besprechung vom 21.04.1992 (K6, Bl. 152 ff. Bd. I d.A.) ist - neben der vorgegebenen Orientierung an der Heimmindestbauverordnung - zu entnehmen, dass keine aufwändige Wäscherei, sondern ein Waschmaschinenraum und dass ferner nur eine Verteilerküche eingeplant werden sollten sowie fernerhin, dass die Nutzung und Aufbereitung von Oberflächenwasser entfallen sollten. Für sämtliche vorgenannten Besprechungen ist neben dem Zeugen B--- auch der Kläger in der Liste der Anwesenden aufgeführt und war, wie der Zeuge B--- erklärt hat, auch tatsächlich anwesend.
Fernerhin hat auch der erstinstanzlich tätige Sachverständige K--- in seiner gutachterlichen Stellungnahme vom 08.03.2007 festgestellt, dass die vom Kläger eingeplante eigene Wäscherei, beheizte Dacheinläufe, Abwassersammelbecken, Regenwassersammelbecken und Wärmerückgewinnungsanlage vom Bauherren nicht gewünscht waren (vgl. Bl. 528 ff. Bd. VII d.A.).
Dass die Heimmindestbauverordnung zugrunde zu legen war, was der Zeuge B--- ebenfalls best�ätigt hat, ergab sich bereits aus der Aufgabenstellung vom 25.01.1992 und ist auch in der Niederschrift des Hochbauamts G vom 03.03.1992 über die Baubesprechung vom 27.02.1992 (Anlage K4, Bl. 150 ff. Bd. I d.A.) vermerkt, aus welcher darüber hinaus hervorgeht, dass weder eine Wäscherei noch eine Küche geplant werden sollten.
2.5.
Die Vorplanung des Klägers hat die Planungsvorgaben der Beklagten, auf die vorgenannten kostenintensiven, nicht notwendigen Einrichtungen zu verzichten, nur zum Teil berücksichtigt.
Nach den gutachterlichen Feststellungen der vom Senat beauftragten Sachverständigen D- P---, die der Senat als richtig zugrunde legt, hat der Kläger seine Planung nach den Vorgaben der Krankenhausbauverordnung ausgerichtet, was zu überhöhten Kosten bei der Anlagengruppe 3 (Elektrotechnik) geführt hat, indem er eine - nach den Vorschriften der Heimmindestbauverordnung nicht vorgeschriebene - Notstromversorgung (Kostengruppe 3.2.5.0) und Rufanlage (Kostengruppen 3.2.6.0 und 3.3.6.0) eingeplant hat (vgl. S. 45, 46, 48 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010). Soweit allerdings die sanitären Anlagen über die Voraussetzungen gemäß der Heimmindestbauverordnung hinaus gehen, entspricht dies den Feststellungen der Sachverst�ändigen zufolge den Forderungen des Bauherrn (vgl. S. 34 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
Ferner hat der Kläger die - allerdings erst nach Vertragsschluss konkretisierten - vorerwähnten Planungsvorgaben der Beklagten nicht beachtet und eine Großwäscherei eingeplant, was zu überhöhten Kosten im Bereich der nutzungsspezifischen Anlagen (Kostengruppe 470) und auch bei der Lüftungstechnik (Kostengruppe 430) geführt hat, die auf den Betrieb einer Großwäscherei ausgelegt ist (vgl. S. 73 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
Darüber hinaus hat der Beklagte entgegen den Planungsvorgaben des Bauherrn eine Pathologie (Kostengruppe 3.4.3.1. - 06) und eine Notaufnahme (Kostengruppe 3.4.3.1. - 01) eingeplant (vgl. S. 81 und 82 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
Nicht berücksichtigt wurde auch die Vorgabe, auf beheizte Dacheinläufe zu verzichten; diese sind in den textlichen Erläuterungen aufgeführt. Inwieweit sie bei der Kostenaufgliederung vom 07.04.1992 (Bl. 82 Bd. I d.A.) berücksichtigt wurden, ist allerdings nicht ersichtlich (vgl. S. 89 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
Auf die Planung einer "regulären" Kochküche allerdings hat der Kläger, den Planungsvorgaben folgend, bei der Vorplanung (Leistungsphase 2) verzichtet (vgl. S. 80 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
Der Bauherrenwunsch ist auch insoweit berücksichtigt, als auf die Planung von Abwassersammelbecken, Regenwassersammelbecken und Wärmerückgewinnung - jedenfalls im weiteren Planungsfortschritt - verzichtet worden ist und diese lediglich als Alternative aufgeführt sind, die auch in der Kostenaufgliederung vom 07.04.1992 keine Berücksichtigung mehr finden. Gleiches gilt für das Schwimmbad; diesbezüglich gibt es - dem Bauherrenwunsch entsprechend - nur eine Planung der Anschlusswerte (vgl. S. 87 des Sachverständigengutachtens vom 28.04.2010).
2.6.
Darüber hinaus hat die Beklagte dem Kläger den Feststellungen des Senats zufolge eine Kostenobergrenze für die Technikkosten von 6,5 Mio. DM brutto vorgegeben.
Diesen Kostenrahmen hat der Beklagte auch noch in seiner letzten, überarbeiteten Vorplanung nicht eingehalten und um ca. 1.441.811,-- DM (ca. 22,18 %) überschritten; die für die Technikausrüstung anzusetzen Kosten betragen nach seinem letzten Kostenansatz und der Kostengliederung vom 07.04.1992 noch 6.966.501,37 DM netto, das sind bei Hinzurechnung der Umsatzsteuer (mit dem damals geltenden Umsatzsteuersatz von 14 %) ca. 7.941.811,-- DM brutto.
Nach dem Ergebnis der vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme ist die Beweisbehauptung der Beklagten bestätigt, dass sie dem Kläger eine Kostenobergrenze für die Technikkosten von 6,5 Mio. DM vorgegeben hat.
Zwar kann die Vereinbarung bzw. Vorgabe einer Kostenobergrenze nicht als unstreitig angesehen werden. Der Äußerung des Klägers bei seiner Anhörung in der Sitzung des Landgerichts G vom 22.05.2001 (Bl. 139 ff., 145 Bd. V d.A.) kommt nicht die Wirkung eines gerichtlichen Geständnisses i.S.d. § 288 ZPO zu. Denn im Anwaltsprozess, wie hier, kann ein Geständnis von der nicht postulationsfähigen Partei nicht erklärt werden.
Allerdings kann diese Äußerung des Klägers im Rahmen der Beweiswürdigung Berücksichtigung finden.
So hat auch der Zeuge B--- bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht G am 22.05.2001 (Bl. 139 ff., 145, 148 Bd. V d.A.) ebenso wie bei seiner Vernehmung vor dem Senat am 02.07.2009 (Bl. 791 ff. Bd. VIII d.A.) glaubhaft erklärt, die Beklagte habe für die Technikausrüstung einen Kostenansatz von 6,5 Mio. DM vorgegeben- diese Angaben hält der Senat für zutreffend, zumindest für eine solche Kostenvorgabe am 10. März 1992. An einer Stelle bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht hat der Zeuge sogar erklärt, diese Vorgabe sei bereits im Januar 1992 erfolgt.
In seiner erstinstanzlichen Vernehmung hat der Zeuge B--- allerdings an anderer Stelle angegeben, eine "Kostenobergrenze" durch die Stadt sei im März 1992 festgelegt worden. Diese letzte Angabe kann sich indessen möglicherweise auf die (für den Zeugen B--- als Hauptplaner relevanten) Gesamtbaukosten beziehen. Insoweit steht sie auch mit den Angaben der erstinstanzlich vernommenen Zeugin D--- in Übereinstimmung, die erklärt hat, zwar seien zunächst Gesamtbaukosten von 35 Mio. DM im Gespräch gewesen, doch sei bei der Besprechung am 10.03.1992 eine Obergrenze für die Gesamtbaukosten von 25 Mio. DM vorgegeben worden (vgl. Sitzungsprotokoll des Landgerichts vom 22.05.2001, Bl. 139 ff., 149 Bd. V d.A.).
Die Richtigkeit der Angaben des Zeugen B--- und der Zeugin D--- mit Bezug auf die Vorgabe einer Kostenobergrenze für die Gesamtinvestitionen (einschl. Baunebenkosten) von 25 Mio. DM bei der Besprechung am 10.03.1992 wird durch das von der Zeugin D--- am 18.03.1992 erstellte Protokoll über die Beratung vom 10.03.1992 (Bl. 395 ff., 397 Bd. III d.A.) untermauert. Ferner ergibt sich die Vorgabe einer Gesamtinvestitionssumme von 25 Mio. DM und Technikkosten von 6,5 Mio. DM als Obergrenze auch aus der bereits zitierten Niederschrift eines Mitarbeiters des Hochbauamts der Stadt G vom 22.04.1992 über eine Besprechung vom 21.04.1992 (Anlage K6, Bl. 152 f. Bd. I d.A.).
Überdies hat auch der Kläger selbst im Beweisaufnahmetermin vor dem Landgericht G am 22.05.2001, nachdem er die Angaben des Zeugen B--- gehört hatte, wonach für die Technikkosten eine Vorgabe von 6,5 Mio. DM als Obergrenze galt, und zwar resultierend aus Gesamtkosten von rd. 22 Mio. DM oder aber - so die letzte Äußerung des Zeugen B--- - aufgrund einer (unabhängig hiervon) bereits im Januar 1992 erteilten Vorgabe speziell für Technikkosten die Richtigkeit dieser Angaben bestätigt.
Selbst wenn sich diese Bestätigung des Klägers nicht auf die vom Zeugen B--- zuletzt erwähnte Vorgabe von 6,5 Mio. DM an Technikkosten bereits im Januar 1992 beziehen sollte (was allerdings aufgrund des Zusammenhangs der Aussagen naheläge), sondern nur auf die Ableitung dieses Kostenrahmens für die Technikkosten aus den Gesamtbaukosten, hat der Kläger damit zumindest die bei der Besprechung am 10.03.1992 gemachte Kostenvorgabe persönlich bestätigt. Diese Erklärung geht, zumal sie in Übereinstimmung mit der Zeugenaussage des Architekten B--- steht, den Äußerungen seines Prozessbevollmächtigten im Prozess vor und ihr ist zu folgen.
Nach alledem ist zugrunde zu legen, dass dem Kläger spätestens am 10.03.1992 eine Kostenobergrenze von 6,5 Mio. DM für die Technikausrüstung vorgegeben worden ist.
2.7.
Die Planung des Klägers geht auch an diesen Planungsvorgaben der Beklagten (Kostenrahmen), an denen er sich auszurichten hatte, vorbei.
Eine Berücksichtigung der Planungsvorgaben wäre dem Beklagten indessen möglich und zumutbar gewesen, zumal sich den Angaben des Zeugen B--- zufolge, der hierzu vom Landgericht vernommen worden ist, erst im März 1992 die Vorstellungen der Beklagten konkret herausstellten und genauere Planungsvorgaben gemacht wurden. Diese Angaben des Zeugen hält der Senat für glaubhaft. Sie entsprechen dem, was in den einzelnen Besprechungsprotokollen und sonstigen Unterlagen festgehalten ist. Erstmals im Protokoll über die Besprechung vom 10.03.1992 (Bl. 395 ff. Bd. III d.A.) sind konkretisierte Vorstellungen und Planungsvorgaben der Beklagten als Bauherrin geordnet aufgelistet und schriftlich im Einzelnen festgehalten. Dies gilt auch für den vorgegebenen Kostenrahmen von höchstens 25 Mio. DM für die Gesamtbaukosten (einschl. Baunebenkosten). Protokolle über frühere Besprechungen mit derartig konkreten Wünschen des Bauherren liegen nicht vor.
Dass der Kläger in der Folgezeit die Planungsvorgaben der Beklagten nicht eingehalten hat, ergibt sich bereits aus den glaubhaften Angaben des Zeugen B--- vor dem Landgericht. Dieser hat am 22.05.2001 ausgesagt, dass der Kostenansatz des Klägers zunächst 12 Mio. DM betrug und dann bis auf einen Ansatz von etwa 8 Mio. DM "heruntergerückt" wurde (vgl. S. 6 des Sitzungsprotokolls des Landgerichts G vom 22.05.2001, S. 6, Bl. 139 ff., 144 Bd. V d.A.). Die Richtigkeit der Angaben des Zeugen B--- wird durch den Inhalt des von einem Mitarbeiter des Hochbauamts am 22.04.1992 verfassten Protokolls über eine Beratung vom 21.04.1992 (Anlage K6, Bl. 152 f. Bd. I d.A.) untermauert; hierin ist festgehalten, dass dem Kläger vorgegeben wurde, seine Planung zu überarbeiten und hierbei eine deutliche Kostensenkung von z. Zt. ca. 12,7 Mio. DM auf 6,5 Mio. DM zu erzielen.
Auch die zuletzt vom Kläger am 29.04.1992 der Beklagten übergebene Vorplanung hält den Kostenrahmen von 6,5 Mio. DM jedoch nicht ein.
Nach den Feststellungen der Sachverständigen D- P---, der der Senat folgt, liegen die nach der Planung des Klägers sich ergebenden Kosten für die Technikausrüstung immer noch deutlich über dem vorgegebenen Rahmen; sie betragen knapp 8 Mio. DM brutto (6.966.301,37 DM netto = ca. 7.941.811,-- DM brutto, gemäß der Kostenaufstellung des Klägers). Dies entspricht auch der vom Zeugen B--- genannten Summe; diese Feststellungen der Sachverständigen sprechen damit ebenfalls für die Richtigkeit der Angaben des Zeugen B---.
Dass keine weiteren, aktuelleren Planungen des Klägers vorliegen und die Begutachtung der Sachverständigen dementsprechend auf der richtigen Grundlage basiert, ergibt sich aus dem Schriftsatz des Klägervertreters vom 31.08.2009: hierin wird mitgeteilt, der Kläger habe sämtliche Pläne und Unterlagen bereits mit der Klageschrift (als Anlage K4) vorgelegt (vgl. Bl. 813 f. Bd. VIII d.A.).
Entgegen der Ansicht des Klägers ist für die Kostenobergrenze - ebenso für die Planung - von Bruttobeträgen, nicht aber von Nettobeträgen auszugehen.
Wenn nichts Abweichendes vereinbart ist - und für Abweichungen findet sich weder in den Besprechungsprotokollen noch in den übrigen schriftlichen Unterlagen irgendein Anhaltspunkt - gelten Bruttobeträge.
Auch die für die Kosten von Hochbauten (und damit vorliegend) anzuwendende DIN 276, Teil 1, gibt in ihrer Definition der Kosten vor, dass dies die Aufwendungen für Güter, Leistungen und Abgaben einschließlich Umsatzsteuer sind, die für die Planung und Einrichtung von Hochbauten erforderlich sind.
Der Bundesgerichtshof geht, wie dem Leitsatz Nr. 1 seines Urteils vom 07.11.1996 (VII ZR 23/95, veröffentlicht in juris) eindrucksvoll zu entnehmen ist, ebenfalls davon aus, dass die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen ist; die vergessene Mehrwertsteuer qualifiziert er als groben Fehler bei Kostenermittlungen.
Dementsprechend legt auch der Senat die vom Kläger angesetzten Preise zuzüglich damals geltender Mehrwertsteuer (von 14 %) zugrunde und geht auf der anderen Seite gleichzeitig davon aus, dass es sich der Vorgabe für Technikkosten von 6,5 Mio. DM um einen Bruttobetrag handelt.
Wenn man indessen die Mehrwertsteuer hinzurechnet, kann - entgegen der Ansicht des Klägers wie auch des Landgerichts - nicht mehr von einer sich im Rahmen der hinzunehmenden Toleranzen bewegenden, lediglich geringfügigen Überschreitung des vorgegebenen Kostenrahmens ausgegangen werden. Die Überschreitung liegt hier bei mehr als 22 %.
Eine solche Überschreitung hält sich, selbst wenn man die Obergrenze 6,5 Mio. DM nicht als feste, sondern nur als Circa-Angabe wertet, nicht mehr im Rahmen einer hinzunehmenden Toleranz und führt zur Mangelhaftigkeit der Planung, und zwar auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass vorliegend mit der Vorplanung eine Leistungsphase betroffen ist, die noch von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, weil es sich um ein frühes Planungsstadium handelt.
2.8.
Wegen dieses Planungsmangels (deutliche Überschreitung des von der Beklagten vorgegebenen Kostenrahmens) ist ein Grund für den Ausspruch der außerordentlichen Kündigung durch den Bauherrn gegeben.
Der Architekt ist nach höchstrichterlicher Rechtssprechung (Urteil vom 24.06.1999, VII ZR 196/98), der der Senat folgt, auch in den Fällen, in denen die Parteien eine Kostengrenze nicht als Beschaffenheit des Architektenwerks vereinbart haben, verpflichtet, die ihm bekannten Kostenvorstellungen des Auftraggebers bei seiner Planung zu berücksichtigen.
Diese Pflicht hat der Beklagte selbst noch mit der Vorlage der letzten Planungsunterlagen, also nachdem er bereits zur Nachbesserung im Sinne der Vorlage einer Planung mit geringeren Technikkosten aufgefordert worden war, nicht erfüllt, sondern auch diese letzte, nachgebesserte bzw. angepasste Vorplanung überschreitet den Kostenrahmen um mehr als 22 % und liegt damit deutlich über dem Rahmen des von der Klägerin Hinzunehmenden.
Sofern eine bestimmte Bausumme als Kostenrahmen vereinbart ist (hier hat die Beklagte als Bauherrin eine Summe für die Technikkosten von 6,5 Mio. DM als Obergrenze vorgegeben, und der Kläger hat diese Vorgabe entgegengenommen; dafür, dass dieser Rahmen ohnehin bei der Planung unter Berücksichtigung der Bauherrenwünsche nicht hätte eingehalten werden können oder aber dafür, dass der Kläger erklärt hätte, diese Vorgabe sei nicht umsetzbar, gibt es keinerlei Anhaltspunkte) hat der Architekt diesen einzuhalten. Wird der Rahmen überschritten, bedeutet dies einen Mangel des Architektenwerks.
Ob in diesem Zusammenhang überhaupt irgendeine Toleranz in Betracht kommt und ggf. in welchem Umfang, richtet sich nach dem Vertrag. Erst wenn sich im Vertrag - bzw. vorliegend in den nachfolgenden Vereinbarungen und Verabredungen (die Kostenvorgabe erfolgte nämlich möglicherweise - und dies legt der Senat zugrunde - erst am 10.03.1992) - Anhaltspunkte dafür finden, dass die vorgegebene Bausumme nur eine Größenordnung oder eine bloße Orientierung sein soll, können Erwägungen zu Toleranzen angestellt werden (vgl. BGH, Urteil vom 23.01.1997, VII ZR 171/95; OLG Naumburg, Urteil vom 14.10.2003, 11 U 1610/97).
Dass die Vorgabe von 6,5 Mio. DM als Obergrenze für die Technikkosten hier nur eine bloße Orientierungsgröße sein sollte, ist jedoch nicht ersichtlich. Vielmehr wurde diese Grenze strikt vorgegeben. Selbst wenn man, da zugleich die Höchstgrenze für die Gesamtinvestitionen mit ca. 22 bis 25 Mio. DM (letzteres allerdings incl. Baunebenkosten), also keiner festen, ganz konkreten Vorgabe angegeben wurde, auch die Vorgabe von 6,5 Mio. DM für die Technikkosten als Circa-Angabe verstehen sollte, ist die Toleranzgrenze mit der vorgelegten, den Rahmen um mehr als 22 % überschreitenden Kosten deutlich überschritten.
Nach alledem war die vom Kläger vorgelegte Vorplanung mangelhaft.
Dementsprechend war die Beklagte zu der mit Schreiben vom 28.08.1992 (Bl. 53 f. Bd. I d.A.) ausgesprochenen außerordentlichen Kündigung des Vertrags berechtigt. Hierbei ist auch zu sehen, dass die Beklagte dem Kläger nach der Besprechung vom 21.04.1992 noch eine Möglichkeit der "Nachbesserung" gewährt hatte, indem dieser aufgefordert wurde, die Vorplanung zu überarbeiten und dabei eine Kostensenkung auf 6,5 Mio. DM zu erzielen (vgl. Besprechungsprotokoll über den 21.04.1992 (Anlage K2, Bl. 52 ff., 153 Bd. I d.A.). Trotz der Nachbesserungsmöglichkeit hielt indessen - wie dargelegt - auch die zuletzt vom Kläger vorgelegte Planung den vorgegebenen Kostenrahmen nicht ein.
2.9.
Zwar hat die außerordentliche Kündigung des Vertrags grundsätzlich, wie bereits ausgeführt, nur Auswirkungen auf noch ausstehende Leistungen und nicht auf die bereits erbrachten Leistungen.
Allerdings scheidet nach höchstrichterlicher Rechtssprechung, die der Senat bei seiner Rechtsanwendung zugrunde legt, ein Vergütungsanspruch aus, solange die Leistungen des Klägers mangelhaft oder auch für die Beklagte nicht brauchbar sind. Das bedeutet, für die erbrachten Leistungen kann der Kläger ein Honorar nur verlangen, wenn sie mangelfrei sind (vgl. BGH, Urteil vom 25.03.1993, X ZR 17/92 für einen Werkvertrag über die Erstellung von Datenerfassungsprogrammen; ferner BGH, Urteil vom 24.06.1999, VII ZR 196/98 für den Architektenvertrag sowie OLG Naumburg, Urteil vom 14.10.2003, 11 U 1610/97 und OLG Frankfurt, Urteil vom 22.10.1992, 3 U 129/91).
Selbst bei mangelfreier Leistung steht dem Auftragnehmer ein Honorar für erbrachte Leistungen nach höchstrichterlicher Rechtssprechung nicht zu, wenn der Auftraggeber darlegen und ggf. beweisen kann, dass die erbrachte Leistung für ihn nicht brauchbar oder ihm deren Verwendung nicht zumutbar ist.
Wie bereits dargestellt, ist die Planungsleistung des Klägers wegen Nichteinhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens, aber auch wegen Nichtberücksichtigung der von der Beklagten vorgegebenen Dimensionierung (Ausrichtung an der Heimmindestbauverordnung, Verzicht auf Wäscherei) mangelhaft.
Damit aber war die Planung im vorliegenden Fall zugleich für die Beklagte unter wirtschaftlichem bzw. finanziellem Aspekt ohne Wert (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 22.10.1992, 3 U 129/91).
Der Umstand, dass die Planungsleistungen in späteren Leitungsphasen hätten korrigiert werden können und dass die Leistung des Klägers prinzipiell nachbesserungsfähig war, führt auch nicht zu einem Vergütungsanspruch des Klägers, und zwar nicht einmal zu einem geminderten Vergütungsanspruch.
Zwar hat die Sachverständige D- P--- bei ihrer Anhörung am 29.07.2010 auf Frage des Klägervertreters erklärt, die festgestellte Überschreitung des Kostenrahmens hätte in der nachfolgenden Leistungsphase korrigiert werden können.
Der Beklagten war es indessen nicht zumutbar, eine (weitere) Überarbeitung durch den Kläger vornehmen zu lassen. Nachdem auch noch die überarbeitete, zuletzt vorgelegte Version der Planung nicht den Planungsvorgaben entsprach, musste dem Kläger eine Möglichkeit zur erneuten Nachbesserung nicht eingeräumt werden.
Der Beklagten war es auch nicht zumutbar, die Vorplanung des Klägers durch einen Dritten (einen neu zu beauftragenden Fachingenieur) weiter verwenden und überarbeiten zu lassen.
Die Übernahme der Pläne in einer weiteren Planungsphase war nicht ohne Weiteres möglich, sondern die Überarbeitung wäre, wie die Sachverständige D- P--- erläutert hat, mit einem gewissen Planungsaufwand verbunden gewesen, insbesondere im Bereich der Elektrotechnik, dort der Rufanlagen (vgl. Sitzungsprotokoll vom 29.07.2010, Bl. 890 ff., 891 Bd. IX d.A.).
Die Weiterverwendbarkeit einer fehlerhaften Planung mittels Überarbeitung durch einen anderen Architekten ist überdies nur eingeschränkt möglich. Es ist nicht ohne Weiteres zu erwarten, dass der Nachfolger die Planungen übernimmt und fortsetzt. Jeder Architekt - auch ein Fachplaner - hat seine eigenen Vorstellungen darüber, wie er eine Bauaufgabe lösen will, und dementsprechend gestaltet er seine Entwürfe. Ein Bauherr, der ihm zu weit gehende Vorschriften macht und einen Entwurf vorlegt, läuft Gefahr, dass der neue Planer den Entwurf ablehnt oder dem Verlangen, ihn zu übernehmen (und zu überarbeiten) nur ungern nachkommt, so dass die weitere Baubearbeitung des Bauvorhabens darunter leidet (so auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.02.1970, 20 U 99/69, BauR 1970, 119 f.; OLG Naumburg, Urteil vom 08.11.1995, 6 U 153/95).
Außerdem hatte die Beklagte allen Grund, der Planung des Klägers zu misstrauen. Dieser hatte, wie dargestellt, nicht nur den vorgegebenen Kostenrahmen selbst mit der zuletzt vorgelegten Planung überschritten, sondern darüber hinaus auch weitere, wesentliche Planungsvorgaben der Beklagten ignoriert (insbesondere die Ausrichtung der Planung an den Vorgaben der Heimmindestbauverordnung und den Verzicht auf die Wäscherei).
Für die mangelhaften Leistungen des Klägers hat die Beklagte nach alledem keinerlei Vergütung zu entrichten.
3.
Nach alledem war auf die Berufung der Beklagten die Klage unter Abänderung des Urteils des Landgerichts G abzuweisen.
Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Revisionszulassungsgründe i.S.d. § 542 II ZPO sind nicht gegeben.