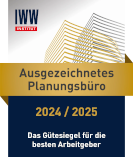18.03.2025 · IWW-Abrufnummer 247120
Landgericht Krefeld: Urteil vom 13.02.2025 – 5 O 124/23
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Landgericht Krefeld, Urteil vom 13.02.2025, Az. 5 O 124/23
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 282.563,26 nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14.07.2023 zu zahlen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 24% und die Beklagte zu 76%.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
1
Tatbestand
2
Unter dem 13.08./20.08.2020 schlossen die Parteien einen Generalplanervertrag. Im Rahmen dieses Vertrages wurden der Klägerin Generalplanerleistungen für das Bauvorhaben der Beklagten „I., V.-straße, Q.“ übertragen. Es handelt sich um ein komplexes Neubauvorhaben, in dem eine Grundschule, eine Sporthalle, eine Kita, ein Familienzentrum und ein Tagespflegestützpunkt untergebracht werden sollen, außerdem ist der Betrieb einer Quartiersgarage vorgesehen. Mit den Leistungen, für deren Umfang auf den Generalplanervertrag, vorgelegt als Anl. KUP1 zur Klageschrift, Bezug genommen wird, wurde die Klägerin stufenweise beauftragt (bislang: Stufe 1: LPH 1-3, Stufe 2: LPH 5-7).
3
Regelungen zur Vergütung der Klägerin sind unter Ziffer 6.1. des Generalplanervertrages wie folgt getroffen:
4
„6.1.1 Die zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Honorargrundlagen und das vereinbarte Honorar ergeben sich aus der Anlage 1 zu diesem Vertrag (finales Angebot des Auftragnehmers vom 08.07.2020 inkl. aller Anlagen (hier: Anlage 12.1 - VgV - ANG Formularblatt „Honorarangebot“; Anlagen 12.1.1 bis 12.1.12)).
5
6.1.2 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden für Leistungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber bestätigten Kostenberechnung ermittelt. Soweit diese noch nicht vorliegt, ist die Kostenschätzung zugrunde zu legen.“
6
Im als Anlage 12.11.1 VgV-AnG bezeichneten Formularblatt „Honorarangebot“ (Anl. KUP2 zur Klageschrift) wurde zu vorläufigen anrechenbaren Kosten der Kostenrahmen für KG 300-500 von der Beklagten mit netto EUR 18.530.000 vorgegeben, aufgegliedert für KG 300 netto EUR 12.275.000, für KG 400 netto EUR 4.995.000, für KG 500 netto EUR 840.000 und für KG 540 (Abwasserentsorgung) netto EUR 420.000. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Anlage KUP2 Bezug genommen.
7
Noch vor dem Zuschlag hatte die Klägerin der Beklagten eine sog. Kostenplausibilisierung überlassen, die die zu erwartenden Baukosten der Kostengruppen 300-500 mit brutto etwa EUR 21,84 Mio. (= netto etwa EUR 18,5 Mio.) bezifferte und die dabei handschriftlich vermerkte, dass hierin ein GU-Zuschlag nicht eingepreist sei (wörtlich: „gesamt KG 300+400+500/…/gesamt inkl. Indexierung ohne GU-Zuschlag 21.842.982 €“).
8
Am 31.03.2021 legte die Klägerin im Zuge der Erarbeitung der Leistungen der ersten Abrufstufe eine Kostenschätzung vor. In ihr sind die Kosten der KG 300 ‒ 500 ausgewiesen und in einer davon abgrenzten nachgestellten Zeile findet sich die Bezeichnung „GU-Zuschlag 20% nach Angabe AG auf die KG 300-500“.
9
Ob ein GU-Zuschlag bei anrechenbaren Kosten zu berücksichtigen ist oder nicht und damit Einfluss auf die Höhe des Architektenhonorars hat, ist der Gegenstand des Streits der Parteien.
10
Unter dem 18.10.2021 legte die Klägerin die Kostenberechnung vor, die sie unter dem 18.03.2022 aktualisiert hat. Diese Kostenberechnung weist entsprechend der von ihr hierzu vertretenen Ansicht einen 20%-Zuschlag als Teil der anrechenbaren Kosten der KG 300-500 aus.
11
Am 10.12.2021 rief die Beklagte die Stufe 2 des Generalplanervertrages ab (LPH 5-7) und widersprach gleichzeitig der Forderung der Klägerin, einen GU-Zuschlag in Ansatz bringen zu können. Um den weiteren Bauablauf nicht zu stören, einigten sich die Parteien darauf, die Ausführung der weiteren beauftragten Leistungen nicht von der Klärung der Honorarberechnungsgrundlage abhängig zu machen. Am 08.04.2022 gab die Beklagte die Kostenberechnung der Klägerin vom 18.03.2022 frei, dies allerdings mit der Maßgabe, dass der 20%-Zuschlag aus den im Übrigen unstreitigen anrechenbaren Kosten der KG 300-500 herauszunehmen sei. Dem widersprach die Klägerin. Sie erstellte sodann unter dem 28.03.2023 dem Leistungsstand entsprechend und auf Basis ihrer Rechtsauffassung zur Anrechenbarkeit des vereinbarten 20%-GU-Zuschlags die 14. Abschlagsrechnung Nr. AR-23-0076-100. Diese endete auf einen offenen Forderungsbetrag in Höhe von 418.060,28 € brutto. Hierauf wies die Beklagten einen Betrag von EUR 53.701.08 an und strich aus der Rechnung der Klägerin insbesondere den hier zwischen den Parteien streitigen Betrag von EUR 360.023,40 als Kürzung des sog. GU-Zuschlags heraus. Unter dem 31.01.2024 hat die Klägerin sodann ihre 17. Abschlagsrechnung über brutto EUR 476.537,75 vorgelegt, auf die die Beklagte EUR 42.069.68 gezahlt hat, nachdem sie auch aus dieser Rechnung den Ansatz eines GU-Zuschlages von 20% auf die KG 300-500 neben einer Leistungsstandskürzung von brutto EUR 60.632,40 herausgestrichen hatte.
12
Mit der Klage hat die Klägerin zunächst den vermeintlich offenen Betrag von EUR 360.023,40 aus der 14. Abschlagsrechnung geltend gemacht. Nach Vorlage der 17. Abschlagsrechnung hat sie die Klage erhöht und ist nunmehr der Ansicht, einen fälligen Anspruch auf Zahlung von EUR 373.835,67 aus der 17. Abschlagsrechnung gegen die Beklagte zu haben. Zur Begründung ihres Anspruchs, einen GU-Zuschlag auf die anrechenbaren Kosten verlangen zu können, behauptet sie, dass die Beklagte von Beginn an eine GU-Vergabe beabsichtigt habe. In diesem Zusammenhang beruft sie sich auf den geschlossenen Generalplanervertrag und hier auf die unter Ziffer 2.4. „Unternehmereinsatzform“ getroffene Regelung „Die Vergabestrategie für die Bauleistung sieht eine GU-Vergabe vor“. Sie meint, dass die zusätzlichen Kosten, die bei der Beauftragung eines Generalunternehmers ‒ wie insoweit unstreitig - erfahrungsgemäß anfielen, in der Kostenberechnung zu erfassen seien, damit die von dem Bauherrn zu erwartenden Kosten der Bauausführung in dieser Berechnung überhaupt zutreffend abgebildet seien, nachdem sie nichts Anderes seien als unternehmerische Kosten der Herstellung des Bauwerks. Auf diese zusätzlichen Baukosten habe sie die Beklagte auch bereits vor dem Zuschlag im Rahmen der von ihr erstellen Kostenplausibilisierung hingewiesen. Seien sie aber in der Kostenberechnung erfasst, seien sie damit auch Grundlage des von dem Planer zu beanspruchenden Honorars. Zur Höhe des zu beanspruchenden GU-Zuschlages hat sich die Klägerin zunächst darauf berufen, dass die Beklagte selbst von einer durch die Beauftragung eines Generalunternehmers verursachten Teuerung von 20% ausgegangen sei.
13
Die Klägerin hat zunächst beantragt,
14
die Beklagte zu verurteilen, an sie EUR 373.835,67 nebst Verzugszinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
15
Nachdem die Klägerin sodann unwidersprochen vorgetragen hat, dass ein GU-Zuschlag, so er Berücksichtigung bei den anrechenbaren Kosten finden dürfe, mit jedenfalls 13,75% in Ansatz zu bringen sein würde, steht zwischen den Parteien nicht im Streit, dass sich unter dieser Prämisse bei Zugrundelegung des von der Beklagten mit der 17. Abschlagsrechnung geprüften Leistungsstandes und bei Berücksichtigung eines GU-Zuschlages von “nur“ 13,75% aus dieser Abschlagsrechnung ein offener Honoraranspruch der Klägerin in Höhe von EUR 282.563,26 ergeben würde.
16
Die Klägerin beantragt unter teilweiser Klagerücknahme nunmehr,
17
die Beklagte zu verurteilen, an sie EUR 282.563,26 nebst Verzugszinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
18
Die Beklagte beantragt,
19
die Klage abzuweisen.
20
Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Klägerin einen Zuschlag für GU-Beauftragung schon deshalb nicht bei den anrechenbaren Kosten berücksichtigen dürfte, weil sie einen GU-Zuschlag in ihrem Angebot, auf das sie den Zuschlag im Vergabeverfahren erhalten habe, auch nicht eingepreist habe. Genau das ergebe sich auch aus der Unterlage der Klägerin zur Kostenplausibilisierung, die sie, die Beklagte so verstanden habe, dass ein GU-Zuschlag bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten außer Ansatz bleiben solle. Sie meint, dass in dem Angebot der Klägerin und der Annahme der Beklagten durch Erteilung des Zuschlags eine Einigung der Parteien auch darüber zustande gekommen sei, dass im honorarrechtlichen Zusammenhang mit einem sog. GU-Zuschlag weder die anrechenbaren Kosten nachträglich geändert noch sonstige Zuschläge auf das Honorar erhoben werden können. So sei in diesem Sinne unter Ziffer 6.1.1. auch ausdrücklich auf die in der Anlage 12.1. vereinbarten Honorargrundlagen verwiesen. Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass es der Klägerin damit jedenfalls unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben verwehrt sei, sich nun auf die Anrechenbarkeit eines GU-Zuschlages zu berufen, wodurch ihr Angebot - wie die Klage zeige - deutlich verteuert sei. Im Übrigen sei es auch technisch falsch, Zuschläge wie den GU-Zuschlag bereits in der Kostenberechnung zu erfassen, sie gehörten in den honorarrechtlich keine Rolle mehr spielenden Kostenvoranschlag oder den Kostenanschlag. Ferner beruft sich die Beklagte auf Ziffer 6.1.2. des Generalplanervertrages und damit darauf, dass nach der vertraglichen Gestaltung die bestätigte Kostenberechnung Grundlage der Honorarberechnung habe sein sollen, ein GU-Zuschlag von ihrer Bestätigung aber gerade ausgenommen worden sei.
21
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
22
Die Klageschrift ist der Beklagten am 14.07.2023 zugestellt worden.
23
Entscheidungsgründe
24
Die Klage ist begründet.
25
Sie hat in Höhe von EUR 282.563,26 nebst zuerkannter Zinsen Erfolg.
26
In dieser Höhe steht der Klägerin ein fälliger Honoraranspruch aus der 17. Abschlagsrechnung zu. Sowohl nach der HOAI 2013 als auch nach der HOAI 2021 richtet sich das von dem Architekten zu beanspruchende Honorar bei Bauvorhaben wie dem hier in Rede stehenden nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, soweit keine Kostenberechnung vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschätzung, nach dem Leistungsbild, der Honorarzone und der dazugehörigen Honorartafel, § 6 Abs. 1 HOAI 2013/2021. Entsprechend spielt es für die Entscheidung dieses Rechtsstreits keine Rolle, dass für die erste der von der Beklagten beauftragten Stufen die HOAI 2013 gilt, für die zweite dagegen die HOAI 2021. Die Beklagte hatte die Klägerin ausdrücklich stufenweise beauftragt und zwar nach Ausübung eines Optionsrechts, so dass die Parteien letztlich mehrere Einzelverträge für die jeweiligen Stufen abgeschlossen haben mit der Folge, dass die beiden hier in Rede stehenden Einzelverträge der HOAI in jeweils anderer Fassung unterliegen.
27
Von den genannten Honorarparametern steht zwischen den Parteien allein die Frage in Streit, ob die der Höhe nach im Übrigen unstreitigen anrechenbaren Kosten, wie sie in die Kostenberechnung der Klägerin eingeflossen sind, um einen GU-Zuschlag zu erhöhen sind oder nicht.
28
Anrechenbare Kosten sind gem. § 4 Abs. 1 S. 1 und 2 HOAI 2013/2021 Teil der Kosten für die Herstellung, den Umbau, die Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung von Objekten sowie für die damit zusammenhängenden Aufwendungen. Sie sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln. Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 2008 (DIN 276-1:2008-12) gem. § 4 Abs. 1 S. 3 HOAI 2013/2012 zugrunde zu legen, wenn in dieser Verordnung ‒ wie es für den vorliegenden Fall zutrifft ‒ im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen wird. In dieser ist der Zweck der Kostenberechnung dahin beschrieben, als Grundlage für die Entscheidung über die Entwurfsplanung (LPH 3) dienen zu sollen. Nach Ziffer 3.4.3. der in Bezug genommenen DIN werden in der der Kostenberechnung deshalb insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
29
30
Planungsunterlagen, z.B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des Bauvorhabens), ggfls. auch Detailpläne mehrfach wiederkehrender Raumgruppen;
31
Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen;
32
Erläuterungen, z.B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber für die Berechnung und die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind.
33
Gem. § 2 Nr. 11 S. 3 HOAI müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden. Auch hier wird hervorgehoben, dass die Kostenberechnung die für die Beurteilung der Kosten relevanten Erläuterungen zu enthalten hat, § 2 Nr. 11 S. 2 HOAI. Damit wird die Kostenberechnung zur Grundlage der Finanzierungsüberlegungen des Bauherrn. Durch sie erfährt er, mit welchen Kosten er zu rechnen haben wird, wenn er sich dazu entschließt, das Bauvorhaben dem jetzigen Planungsstand (LPH 3) entsprechend zu realisieren. Dies impliziert, dass es hier darum geht, in KG 300-500 die unternehmerischen Kosten zu erfassen, die die Bauleistungen mit sich bringen werden, die nach der Planung vorgesehen sind. Hier sind nach Auffassung des in dieser Sache erkennenden Gerichts auch die Kosten einzuordnen, die bei einem Generalunternehmereinsatz anfallen. Diese oftmals auch als Regiekosten benannten Kosten sind Kosten, die für die vertragliche Bindung und Koordinierung der Nachunterunternehmer durch den Generalunternehmer aufzuwenden sind und an den Bauherrn durch insoweit höhere Preise für die Bauleistungen weitergegeben werden. Diese Kosten sind damit unternehmerische Kosten, die zu den Bauleistungen gehören und haben mit planerischen Kosten nichts gemein. Sie sind die Kosten, um die das Bauen als solches teurer wird. Entsprechend gehören sie zu den Kosten des Bauwerks und sind somit auch in der Kostenberechnung unter KG 300-500 zu erfassen. Wird durch sie das Bauvorhaben für den Bauherrn teurer, darüber ist er darüber mit der Kostenberechnung zu unterrichten (so auch Korbion/Mantscheff/Vygen HOAI, 9. Aufl. § 33 Rz. 96; Locher, Koeble, Frik § 33 Rz 13; Fuchs/Berger/Seifert, § 33 Rz 83). Zwar stellt sich ein Bauvorhaben auch durch andere Kosten, erfasst unter der Kostengruppe 700 als Baunebenkosten, teurer. Unter die KG 710 ‒ 770 lassen sich die Kosten als Folge eine GU-Zuschlages allerdings nicht fassen, sie alle haben ‒ anders als der GU-Zuschlag ‒ auch nichts mit den unternehmerischen Kosten zu tun, die durch die Bauleistungen als solche anfallen und sich in den reinen Baukosten niederschlagen.
34
Danach hat die Klägerin den GU-Zuschlag in zutreffender Weise bei den anrechenbaren Kosten in der von ihr erstellten Kostenberechnung berücksichtigt. Über die Höhe der Kosten, mit denen bei einem GU-Einsatz bei Erstellung der Kostenberechnung zu rechnen war, ist der Streit zwischen den Parteien beendet. Er ist nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag der Klägerin mit einem Aufschlag von 13,75% zu berücksichtigen.
35
Unstreitig ist zwischen den Parteien weiter, dass sich aus der 17. Abschlagsrechnung der Klägerin ein offener Honoraranspruch in Höhe des von ihr noch verlangten Betrages ergibt, setzt man diesen Aufschlag den anrechenbaren Kosten hinzu und kommt zudem zu dem Ergebnis, dass die so ermittelten anrechenbaren Kosten auch zur Grundlage ihrer Honorarberechnung werden konnten. Auch das ist der Fall.
36
Die Beklagte beruft sich unter Bezugnahme auf die Vertragsklausel 6.1.2. insoweit zu Unrecht darauf, die von der Klägerin vorgelegte Kostenberechnung nicht bestätigt zu haben, soweit es den Ansatz des GU-Zuschlages betrifft. Hieraus kann sie nicht den Schluss ziehen, diese Kosten dürften nicht zur Grundlage der Honorarberechnung der Klägerin werden. Die vorgenannte Klausel ist unwirksam (BGH VII ZR 314/13). Es kann auch aus Sicht des Gerichts keinem Zweifel unterliegen, dass eine solche Vertragsklausel den Architekten in unangemessener Weise benachteiligen würde. Sie eröffnete dem Auftraggeber die einseitige Entscheidung darüber, welches Honorar der Architekt erhalten soll, das nach der Verordnung tatsächlich aber auf der Grundlage einer objektiv zutreffenden Kostenberechnung zu ermitteln ist. Im vorliegenden Fall ist von dieser Honorarermittlungsgrundlage von den Parteien auch nach der von ihnen getroffenen vertraglichen Abrede nicht einvernehmlich abgewichen worden. Im Gegenteil greifen die unter Ziffer 6.1.1. und 6.1.2. genannten Klauseln die Honorarermittlungsparameter der HOAI 2013/2021 auf, wie sie in § 6 HOAI aufgeführt sind. Die Klägerin verhält sich durch den Aufschlag des GU-Zuschlages schließlich auch nicht treuwidrig. Ihre Kostenberechnung ist durch die Berücksichtigung dieses Zuschlages erst „richtig“, ohne ihn hätte sie die Baukosten, mit denen im Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung zu rechnen war, eben nicht vollständig und damit dann auch unzutreffend erfasst. Der Umstand, dass die Beklagte selbst die vorläufigen anrechenbaren Kosten in der Anlage 12.1. VgV, die zum Bestandteil des Generalplanervertrages geworden ist, ohne Berücksichtigung von GU-Zuschlägen aufgeführt hatte, bedeutet nicht, dass sich die Klägerin in Widerspruch zu ihrem Angebot setzt, auf das sie den Zuschlag erhalten hatte und das auch unter dem Blickwinkel nicht, dass der Generalunternehmereinsatz bereits in diesem Vertrag unter Ziffer 2.4 mit den Worten“ die Vergabestrategie für die Bauleistung sieht eine GU-Vergabe vor“ ins Auge gefasst worden war. Die Klägerin hatte ihr Angebot auf Grundlage der Vorgabe der Beklagten zu vorläufigen anrechenbaren Kosten abgegeben und in ihrer Kostenplausibilisierung, die von der Beklagten zu den Vertragsunterlagen genommen und ihr von der Klägerin vor dem Zuschlag übergeben worden ist, klar darauf hingewiesen, dass sie ‒ wie die Beklagte ‒ zu diesem Zeitpunkt von vorläufigen anrechenbaren Kosten von netto EUR 18,5 Mio. ausgeht, das aber ohne Berücksichtigung eines GU-Zuschlages. Bei verständiger Würdigung kann dieser Zusatz der Klägerin „gesamt inkl. Indexierung ohne GU-Zuschlag (brutto) 21.842.982 €“ nur so verstanden werden, dass dieser dabei noch nicht angesetzt ist. Dass er das auch später nicht werden soll, ist diesem Zusatz indes in keiner Weise zu entnehmen und hätte auch von der Beklagten mit Rücksicht darauf, dass die Parteien bei Vertragsschluss mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer HOAI-konformen Abrechnung ausgegangen waren, nach allem so auch nicht verstanden werden dürfen.
37
Der zuerkannte Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. 2, 291 ZPO.
38
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
39
Streitwert: EUR 373.835,67.
40
Rechtsbehelfsbelehrung:
41
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,
42
1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder
43
2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Landgericht zugelassen worden ist.
44
Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils schriftlich bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils (Datum des Urteils, Geschäftsnummer und Parteien) gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.
45
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Oberlandesgericht Düsseldorf zu begründen.
46
Die Parteien müssen sich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.
47
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
48
Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:
49
Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Auf die Pflicht zur elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicher/innen ab dem 01.01.2022 durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 und das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird hingewiesen.
Tenor:
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 24% und die Beklagte zu 76%.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
1
Tatbestand
2
Unter dem 13.08./20.08.2020 schlossen die Parteien einen Generalplanervertrag. Im Rahmen dieses Vertrages wurden der Klägerin Generalplanerleistungen für das Bauvorhaben der Beklagten „I., V.-straße, Q.“ übertragen. Es handelt sich um ein komplexes Neubauvorhaben, in dem eine Grundschule, eine Sporthalle, eine Kita, ein Familienzentrum und ein Tagespflegestützpunkt untergebracht werden sollen, außerdem ist der Betrieb einer Quartiersgarage vorgesehen. Mit den Leistungen, für deren Umfang auf den Generalplanervertrag, vorgelegt als Anl. KUP1 zur Klageschrift, Bezug genommen wird, wurde die Klägerin stufenweise beauftragt (bislang: Stufe 1: LPH 1-3, Stufe 2: LPH 5-7).
3
Regelungen zur Vergütung der Klägerin sind unter Ziffer 6.1. des Generalplanervertrages wie folgt getroffen:
4
„6.1.1 Die zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Honorargrundlagen und das vereinbarte Honorar ergeben sich aus der Anlage 1 zu diesem Vertrag (finales Angebot des Auftragnehmers vom 08.07.2020 inkl. aller Anlagen (hier: Anlage 12.1 - VgV - ANG Formularblatt „Honorarangebot“; Anlagen 12.1.1 bis 12.1.12)).
5
6.1.2 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden für Leistungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber bestätigten Kostenberechnung ermittelt. Soweit diese noch nicht vorliegt, ist die Kostenschätzung zugrunde zu legen.“
6
Im als Anlage 12.11.1 VgV-AnG bezeichneten Formularblatt „Honorarangebot“ (Anl. KUP2 zur Klageschrift) wurde zu vorläufigen anrechenbaren Kosten der Kostenrahmen für KG 300-500 von der Beklagten mit netto EUR 18.530.000 vorgegeben, aufgegliedert für KG 300 netto EUR 12.275.000, für KG 400 netto EUR 4.995.000, für KG 500 netto EUR 840.000 und für KG 540 (Abwasserentsorgung) netto EUR 420.000. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Anlage KUP2 Bezug genommen.
7
Noch vor dem Zuschlag hatte die Klägerin der Beklagten eine sog. Kostenplausibilisierung überlassen, die die zu erwartenden Baukosten der Kostengruppen 300-500 mit brutto etwa EUR 21,84 Mio. (= netto etwa EUR 18,5 Mio.) bezifferte und die dabei handschriftlich vermerkte, dass hierin ein GU-Zuschlag nicht eingepreist sei (wörtlich: „gesamt KG 300+400+500/…/gesamt inkl. Indexierung ohne GU-Zuschlag 21.842.982 €“).
8
Am 31.03.2021 legte die Klägerin im Zuge der Erarbeitung der Leistungen der ersten Abrufstufe eine Kostenschätzung vor. In ihr sind die Kosten der KG 300 ‒ 500 ausgewiesen und in einer davon abgrenzten nachgestellten Zeile findet sich die Bezeichnung „GU-Zuschlag 20% nach Angabe AG auf die KG 300-500“.
9
Ob ein GU-Zuschlag bei anrechenbaren Kosten zu berücksichtigen ist oder nicht und damit Einfluss auf die Höhe des Architektenhonorars hat, ist der Gegenstand des Streits der Parteien.
10
Unter dem 18.10.2021 legte die Klägerin die Kostenberechnung vor, die sie unter dem 18.03.2022 aktualisiert hat. Diese Kostenberechnung weist entsprechend der von ihr hierzu vertretenen Ansicht einen 20%-Zuschlag als Teil der anrechenbaren Kosten der KG 300-500 aus.
11
Am 10.12.2021 rief die Beklagte die Stufe 2 des Generalplanervertrages ab (LPH 5-7) und widersprach gleichzeitig der Forderung der Klägerin, einen GU-Zuschlag in Ansatz bringen zu können. Um den weiteren Bauablauf nicht zu stören, einigten sich die Parteien darauf, die Ausführung der weiteren beauftragten Leistungen nicht von der Klärung der Honorarberechnungsgrundlage abhängig zu machen. Am 08.04.2022 gab die Beklagte die Kostenberechnung der Klägerin vom 18.03.2022 frei, dies allerdings mit der Maßgabe, dass der 20%-Zuschlag aus den im Übrigen unstreitigen anrechenbaren Kosten der KG 300-500 herauszunehmen sei. Dem widersprach die Klägerin. Sie erstellte sodann unter dem 28.03.2023 dem Leistungsstand entsprechend und auf Basis ihrer Rechtsauffassung zur Anrechenbarkeit des vereinbarten 20%-GU-Zuschlags die 14. Abschlagsrechnung Nr. AR-23-0076-100. Diese endete auf einen offenen Forderungsbetrag in Höhe von 418.060,28 € brutto. Hierauf wies die Beklagten einen Betrag von EUR 53.701.08 an und strich aus der Rechnung der Klägerin insbesondere den hier zwischen den Parteien streitigen Betrag von EUR 360.023,40 als Kürzung des sog. GU-Zuschlags heraus. Unter dem 31.01.2024 hat die Klägerin sodann ihre 17. Abschlagsrechnung über brutto EUR 476.537,75 vorgelegt, auf die die Beklagte EUR 42.069.68 gezahlt hat, nachdem sie auch aus dieser Rechnung den Ansatz eines GU-Zuschlages von 20% auf die KG 300-500 neben einer Leistungsstandskürzung von brutto EUR 60.632,40 herausgestrichen hatte.
12
Mit der Klage hat die Klägerin zunächst den vermeintlich offenen Betrag von EUR 360.023,40 aus der 14. Abschlagsrechnung geltend gemacht. Nach Vorlage der 17. Abschlagsrechnung hat sie die Klage erhöht und ist nunmehr der Ansicht, einen fälligen Anspruch auf Zahlung von EUR 373.835,67 aus der 17. Abschlagsrechnung gegen die Beklagte zu haben. Zur Begründung ihres Anspruchs, einen GU-Zuschlag auf die anrechenbaren Kosten verlangen zu können, behauptet sie, dass die Beklagte von Beginn an eine GU-Vergabe beabsichtigt habe. In diesem Zusammenhang beruft sie sich auf den geschlossenen Generalplanervertrag und hier auf die unter Ziffer 2.4. „Unternehmereinsatzform“ getroffene Regelung „Die Vergabestrategie für die Bauleistung sieht eine GU-Vergabe vor“. Sie meint, dass die zusätzlichen Kosten, die bei der Beauftragung eines Generalunternehmers ‒ wie insoweit unstreitig - erfahrungsgemäß anfielen, in der Kostenberechnung zu erfassen seien, damit die von dem Bauherrn zu erwartenden Kosten der Bauausführung in dieser Berechnung überhaupt zutreffend abgebildet seien, nachdem sie nichts Anderes seien als unternehmerische Kosten der Herstellung des Bauwerks. Auf diese zusätzlichen Baukosten habe sie die Beklagte auch bereits vor dem Zuschlag im Rahmen der von ihr erstellen Kostenplausibilisierung hingewiesen. Seien sie aber in der Kostenberechnung erfasst, seien sie damit auch Grundlage des von dem Planer zu beanspruchenden Honorars. Zur Höhe des zu beanspruchenden GU-Zuschlages hat sich die Klägerin zunächst darauf berufen, dass die Beklagte selbst von einer durch die Beauftragung eines Generalunternehmers verursachten Teuerung von 20% ausgegangen sei.
13
Die Klägerin hat zunächst beantragt,
14
die Beklagte zu verurteilen, an sie EUR 373.835,67 nebst Verzugszinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
15
Nachdem die Klägerin sodann unwidersprochen vorgetragen hat, dass ein GU-Zuschlag, so er Berücksichtigung bei den anrechenbaren Kosten finden dürfe, mit jedenfalls 13,75% in Ansatz zu bringen sein würde, steht zwischen den Parteien nicht im Streit, dass sich unter dieser Prämisse bei Zugrundelegung des von der Beklagten mit der 17. Abschlagsrechnung geprüften Leistungsstandes und bei Berücksichtigung eines GU-Zuschlages von “nur“ 13,75% aus dieser Abschlagsrechnung ein offener Honoraranspruch der Klägerin in Höhe von EUR 282.563,26 ergeben würde.
16
Die Klägerin beantragt unter teilweiser Klagerücknahme nunmehr,
17
die Beklagte zu verurteilen, an sie EUR 282.563,26 nebst Verzugszinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
18
Die Beklagte beantragt,
19
die Klage abzuweisen.
20
Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Klägerin einen Zuschlag für GU-Beauftragung schon deshalb nicht bei den anrechenbaren Kosten berücksichtigen dürfte, weil sie einen GU-Zuschlag in ihrem Angebot, auf das sie den Zuschlag im Vergabeverfahren erhalten habe, auch nicht eingepreist habe. Genau das ergebe sich auch aus der Unterlage der Klägerin zur Kostenplausibilisierung, die sie, die Beklagte so verstanden habe, dass ein GU-Zuschlag bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten außer Ansatz bleiben solle. Sie meint, dass in dem Angebot der Klägerin und der Annahme der Beklagten durch Erteilung des Zuschlags eine Einigung der Parteien auch darüber zustande gekommen sei, dass im honorarrechtlichen Zusammenhang mit einem sog. GU-Zuschlag weder die anrechenbaren Kosten nachträglich geändert noch sonstige Zuschläge auf das Honorar erhoben werden können. So sei in diesem Sinne unter Ziffer 6.1.1. auch ausdrücklich auf die in der Anlage 12.1. vereinbarten Honorargrundlagen verwiesen. Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass es der Klägerin damit jedenfalls unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben verwehrt sei, sich nun auf die Anrechenbarkeit eines GU-Zuschlages zu berufen, wodurch ihr Angebot - wie die Klage zeige - deutlich verteuert sei. Im Übrigen sei es auch technisch falsch, Zuschläge wie den GU-Zuschlag bereits in der Kostenberechnung zu erfassen, sie gehörten in den honorarrechtlich keine Rolle mehr spielenden Kostenvoranschlag oder den Kostenanschlag. Ferner beruft sich die Beklagte auf Ziffer 6.1.2. des Generalplanervertrages und damit darauf, dass nach der vertraglichen Gestaltung die bestätigte Kostenberechnung Grundlage der Honorarberechnung habe sein sollen, ein GU-Zuschlag von ihrer Bestätigung aber gerade ausgenommen worden sei.
21
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
22
Die Klageschrift ist der Beklagten am 14.07.2023 zugestellt worden.
23
Entscheidungsgründe
24
Die Klage ist begründet.
25
Sie hat in Höhe von EUR 282.563,26 nebst zuerkannter Zinsen Erfolg.
26
In dieser Höhe steht der Klägerin ein fälliger Honoraranspruch aus der 17. Abschlagsrechnung zu. Sowohl nach der HOAI 2013 als auch nach der HOAI 2021 richtet sich das von dem Architekten zu beanspruchende Honorar bei Bauvorhaben wie dem hier in Rede stehenden nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung oder, soweit keine Kostenberechnung vorliegt, auf der Grundlage der Kostenschätzung, nach dem Leistungsbild, der Honorarzone und der dazugehörigen Honorartafel, § 6 Abs. 1 HOAI 2013/2021. Entsprechend spielt es für die Entscheidung dieses Rechtsstreits keine Rolle, dass für die erste der von der Beklagten beauftragten Stufen die HOAI 2013 gilt, für die zweite dagegen die HOAI 2021. Die Beklagte hatte die Klägerin ausdrücklich stufenweise beauftragt und zwar nach Ausübung eines Optionsrechts, so dass die Parteien letztlich mehrere Einzelverträge für die jeweiligen Stufen abgeschlossen haben mit der Folge, dass die beiden hier in Rede stehenden Einzelverträge der HOAI in jeweils anderer Fassung unterliegen.
27
Von den genannten Honorarparametern steht zwischen den Parteien allein die Frage in Streit, ob die der Höhe nach im Übrigen unstreitigen anrechenbaren Kosten, wie sie in die Kostenberechnung der Klägerin eingeflossen sind, um einen GU-Zuschlag zu erhöhen sind oder nicht.
28
Anrechenbare Kosten sind gem. § 4 Abs. 1 S. 1 und 2 HOAI 2013/2021 Teil der Kosten für die Herstellung, den Umbau, die Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung von Objekten sowie für die damit zusammenhängenden Aufwendungen. Sie sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln. Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 2008 (DIN 276-1:2008-12) gem. § 4 Abs. 1 S. 3 HOAI 2013/2012 zugrunde zu legen, wenn in dieser Verordnung ‒ wie es für den vorliegenden Fall zutrifft ‒ im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen wird. In dieser ist der Zweck der Kostenberechnung dahin beschrieben, als Grundlage für die Entscheidung über die Entwurfsplanung (LPH 3) dienen zu sollen. Nach Ziffer 3.4.3. der in Bezug genommenen DIN werden in der der Kostenberechnung deshalb insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
29
30
Planungsunterlagen, z.B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des Bauvorhabens), ggfls. auch Detailpläne mehrfach wiederkehrender Raumgruppen;
31
Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen;
32
Erläuterungen, z.B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber für die Berechnung und die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind.
33
Gem. § 2 Nr. 11 S. 3 HOAI müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden. Auch hier wird hervorgehoben, dass die Kostenberechnung die für die Beurteilung der Kosten relevanten Erläuterungen zu enthalten hat, § 2 Nr. 11 S. 2 HOAI. Damit wird die Kostenberechnung zur Grundlage der Finanzierungsüberlegungen des Bauherrn. Durch sie erfährt er, mit welchen Kosten er zu rechnen haben wird, wenn er sich dazu entschließt, das Bauvorhaben dem jetzigen Planungsstand (LPH 3) entsprechend zu realisieren. Dies impliziert, dass es hier darum geht, in KG 300-500 die unternehmerischen Kosten zu erfassen, die die Bauleistungen mit sich bringen werden, die nach der Planung vorgesehen sind. Hier sind nach Auffassung des in dieser Sache erkennenden Gerichts auch die Kosten einzuordnen, die bei einem Generalunternehmereinsatz anfallen. Diese oftmals auch als Regiekosten benannten Kosten sind Kosten, die für die vertragliche Bindung und Koordinierung der Nachunterunternehmer durch den Generalunternehmer aufzuwenden sind und an den Bauherrn durch insoweit höhere Preise für die Bauleistungen weitergegeben werden. Diese Kosten sind damit unternehmerische Kosten, die zu den Bauleistungen gehören und haben mit planerischen Kosten nichts gemein. Sie sind die Kosten, um die das Bauen als solches teurer wird. Entsprechend gehören sie zu den Kosten des Bauwerks und sind somit auch in der Kostenberechnung unter KG 300-500 zu erfassen. Wird durch sie das Bauvorhaben für den Bauherrn teurer, darüber ist er darüber mit der Kostenberechnung zu unterrichten (so auch Korbion/Mantscheff/Vygen HOAI, 9. Aufl. § 33 Rz. 96; Locher, Koeble, Frik § 33 Rz 13; Fuchs/Berger/Seifert, § 33 Rz 83). Zwar stellt sich ein Bauvorhaben auch durch andere Kosten, erfasst unter der Kostengruppe 700 als Baunebenkosten, teurer. Unter die KG 710 ‒ 770 lassen sich die Kosten als Folge eine GU-Zuschlages allerdings nicht fassen, sie alle haben ‒ anders als der GU-Zuschlag ‒ auch nichts mit den unternehmerischen Kosten zu tun, die durch die Bauleistungen als solche anfallen und sich in den reinen Baukosten niederschlagen.
34
Danach hat die Klägerin den GU-Zuschlag in zutreffender Weise bei den anrechenbaren Kosten in der von ihr erstellten Kostenberechnung berücksichtigt. Über die Höhe der Kosten, mit denen bei einem GU-Einsatz bei Erstellung der Kostenberechnung zu rechnen war, ist der Streit zwischen den Parteien beendet. Er ist nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag der Klägerin mit einem Aufschlag von 13,75% zu berücksichtigen.
35
Unstreitig ist zwischen den Parteien weiter, dass sich aus der 17. Abschlagsrechnung der Klägerin ein offener Honoraranspruch in Höhe des von ihr noch verlangten Betrages ergibt, setzt man diesen Aufschlag den anrechenbaren Kosten hinzu und kommt zudem zu dem Ergebnis, dass die so ermittelten anrechenbaren Kosten auch zur Grundlage ihrer Honorarberechnung werden konnten. Auch das ist der Fall.
36
Die Beklagte beruft sich unter Bezugnahme auf die Vertragsklausel 6.1.2. insoweit zu Unrecht darauf, die von der Klägerin vorgelegte Kostenberechnung nicht bestätigt zu haben, soweit es den Ansatz des GU-Zuschlages betrifft. Hieraus kann sie nicht den Schluss ziehen, diese Kosten dürften nicht zur Grundlage der Honorarberechnung der Klägerin werden. Die vorgenannte Klausel ist unwirksam (BGH VII ZR 314/13). Es kann auch aus Sicht des Gerichts keinem Zweifel unterliegen, dass eine solche Vertragsklausel den Architekten in unangemessener Weise benachteiligen würde. Sie eröffnete dem Auftraggeber die einseitige Entscheidung darüber, welches Honorar der Architekt erhalten soll, das nach der Verordnung tatsächlich aber auf der Grundlage einer objektiv zutreffenden Kostenberechnung zu ermitteln ist. Im vorliegenden Fall ist von dieser Honorarermittlungsgrundlage von den Parteien auch nach der von ihnen getroffenen vertraglichen Abrede nicht einvernehmlich abgewichen worden. Im Gegenteil greifen die unter Ziffer 6.1.1. und 6.1.2. genannten Klauseln die Honorarermittlungsparameter der HOAI 2013/2021 auf, wie sie in § 6 HOAI aufgeführt sind. Die Klägerin verhält sich durch den Aufschlag des GU-Zuschlages schließlich auch nicht treuwidrig. Ihre Kostenberechnung ist durch die Berücksichtigung dieses Zuschlages erst „richtig“, ohne ihn hätte sie die Baukosten, mit denen im Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung zu rechnen war, eben nicht vollständig und damit dann auch unzutreffend erfasst. Der Umstand, dass die Beklagte selbst die vorläufigen anrechenbaren Kosten in der Anlage 12.1. VgV, die zum Bestandteil des Generalplanervertrages geworden ist, ohne Berücksichtigung von GU-Zuschlägen aufgeführt hatte, bedeutet nicht, dass sich die Klägerin in Widerspruch zu ihrem Angebot setzt, auf das sie den Zuschlag erhalten hatte und das auch unter dem Blickwinkel nicht, dass der Generalunternehmereinsatz bereits in diesem Vertrag unter Ziffer 2.4 mit den Worten“ die Vergabestrategie für die Bauleistung sieht eine GU-Vergabe vor“ ins Auge gefasst worden war. Die Klägerin hatte ihr Angebot auf Grundlage der Vorgabe der Beklagten zu vorläufigen anrechenbaren Kosten abgegeben und in ihrer Kostenplausibilisierung, die von der Beklagten zu den Vertragsunterlagen genommen und ihr von der Klägerin vor dem Zuschlag übergeben worden ist, klar darauf hingewiesen, dass sie ‒ wie die Beklagte ‒ zu diesem Zeitpunkt von vorläufigen anrechenbaren Kosten von netto EUR 18,5 Mio. ausgeht, das aber ohne Berücksichtigung eines GU-Zuschlages. Bei verständiger Würdigung kann dieser Zusatz der Klägerin „gesamt inkl. Indexierung ohne GU-Zuschlag (brutto) 21.842.982 €“ nur so verstanden werden, dass dieser dabei noch nicht angesetzt ist. Dass er das auch später nicht werden soll, ist diesem Zusatz indes in keiner Weise zu entnehmen und hätte auch von der Beklagten mit Rücksicht darauf, dass die Parteien bei Vertragsschluss mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer HOAI-konformen Abrechnung ausgegangen waren, nach allem so auch nicht verstanden werden dürfen.
37
Der zuerkannte Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. 2, 291 ZPO.
38
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
39
Streitwert: EUR 373.835,67.
40
Rechtsbehelfsbelehrung:
41
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,
42
1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder
43
2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Landgericht zugelassen worden ist.
44
Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils schriftlich bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils (Datum des Urteils, Geschäftsnummer und Parteien) gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.
45
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Oberlandesgericht Düsseldorf zu begründen.
46
Die Parteien müssen sich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.
47
Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
48
Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:
49
Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Auf die Pflicht zur elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicher/innen ab dem 01.01.2022 durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 und das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird hingewiesen.