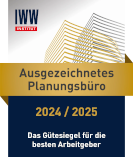18.05.2021 · IWW-Abrufnummer 222412
Oberlandesgericht Düsseldorf: Urteil vom 14.04.2015 – I-23 U 82/14
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
Oberlandesgericht Düsseldorf
Tenor:
Auf die Berufungen des Klägers und der Beklagten wird das am 30. Mai 2014 verkündete Urteil des Vorsitzenden der 1. Kammer für Handelssachen unter Zurückweisung der Rechtsmittel im Übrigen teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 21.143,17 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16. Juli 2013 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Widerklage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz werden dem Kläger zu 4 % und der Beklagten zu 96 % auferlegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Den Parteien wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheits-leistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die jeweils andere Partei in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages Sicherheit leistet.
1
G r ü n d e:
2
I.
3
Die Beklagte beauftragte den Kläger mit der Lieferung und Montage eines Wärmedämmverbundsystems zu einem Werklohn in Höhe von 124.000,00 EUR netto. Der Kläger hat mit seiner Klage restlichen Werklohn in Höhe von 26.981,39 EUR geltend gemacht, davon 2.350,00 EUR Mehrkosten infolge einer geänderten Ausführung eines Abschlussprofils. Die Beklagte hat mit einem Schadensersatzanspruch in Höhe von 134.444,90 EUR die hilfsweise Aufrechnung erklärt und Widerklage in Höhe von 107.463,51 EUR erhoben. Als Mangel hat sie geltend gemacht, dass das Wärmedämmverbundsystem abweichend von der Leistungsbeschreibung mit einem durchlaufenden Brandschutzriegel statt mit Brandschutzlamellen über jeder Bauwerksöffnung ausgeführt worden sei. Der Kläger hat sich darauf berufen, dass die abweichende Ausführung nachträglich mit der Beklagten vereinbart worden sei.
4
Durch die angefochtene Entscheidung, auf die wegen der tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, an den Kläger 19.487,71 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. Oktober 2009 zu zahlen und die Widerklage abgewiesen. Es hat die Werklohnklage teilweise für unbegründet erachtet und einen Anspruch auf Schadensersatz wegen der gegenüber dem Leistungsverzeichnis abweichenden Ausführung des Wärmedämmverbundsystems verneint. Zwar habe der Kläger eine nachträgliche Einigung über die Abänderung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Ausführung mit Brandschutzlamellen nicht zu beweisen vermocht. Der Sachverständige habe aber festgestellt, dass die Ausführung mit dem stattdessen ausgeführten Brandschutzriegel zulässig und gleichwertig sei. Ein Schadensersatzanspruch gemäß § 13 Nr. 7 VOB/B könne daher nicht bejaht werden.
5
Gegen diese Entscheidung wenden sich Kläger und Beklagte mit ihren Berufungen.
6
Der Kläger beanstandet, dass das Landgericht ihm keine Vergütung in Höhe von 2.350,00 EUR wegen der Mehrkosten der geänderten Ausführung des Abschlussprofils zugesprochen hat. Dieser Betrag sei gemäß § 286 Abs. 3 BGB seit dem 25. April 2009 zu verzinsen. Ebenso müsse der vom Landgericht zugesprochene Betrag in Höhe von 19.487,71 EUR ab dem 25. April 2009 verzinst werden, nicht erst ab dem 12. Oktober 2009. Schließlich stehe ihm, dem Kläger, noch Anspruch auf Ersatz außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Höhe von 859,80 EUR zu.
7
Der Kläger beantragt,
8
das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an ihn weitere 2.350,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 25. April 2009, außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 859,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit, sowie Zinsen in Höhe von 2.370,50 EUR zu zahlen;
9
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
10
Die Beklagte beantragt,
11
das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen sowie den Kläger zu verurteilen, an sie 107.463,51 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01. August 2013 zu bezahlen;
12
den Kläger zu verurteilen, an sie 2.586,40 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 05. August 2014 zu zahlen;
13
die Berufung des Klägers zurückzuweisen.
14
Die Beklagte macht geltend, dass das Landgericht § 13 Nr. 7 VOB/B fehlerhaft angewendet habe. Tatsächlich stehe ihr der Schadensersatzanspruch zu, so dass die Werklohnforderung des Klägers erloschen und die Widerklage begründet sei. Den Antrag auf Rückzahlung von 2.586,40 EUR begründet sie damit, dass die ihr Konto führende Sparkasse nach Sicherungsvollstreckung des Klägers durch Pfändungsbeschluss diesen Betrag von ihrem Konto an den Kläger überwiesen hat. Zwar habe der Kläger den Betrag mehrfach rücküberwiesen, die Sparkasse habe aber immer wieder erneut den Betrag zu Lasten ihres Kontos an den Kläger überwiesen.
15
II. Berufung der Beklagten (erster Antrag)
16
1. Die Berufung der Beklagten gemäß der Berufungsbegründung beschränkt sich auf die vom dem Landgericht verneinte Aufrechnung. Allein hierauf bezieht sich die Berufungsbegründung. Eine solche Beschränkung der Berufung ist zulässig (BGH, Urt. v. 30.11.1995 ‒ III ZR 240/94, NJW 1996, 527). Danach ist von dem Senat allein zu überprüfen, ob und ich welcher Höhe die von der Beklagten geltend gemachte Schadensersatzforderung besteht.
17
2. Zu Recht hat das Landgericht eine Schadensersatzpflicht gemäß § 13 Nr. 7 VOB/B in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. September 2006 abgelehnt.
18
a) Die Berufung vertritt die Auffassung, der Kläger habe vorsätzlich statt der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Brandschutzlamellen den umlaufenden Brandschutzgurt eingebaut, weshalb er gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 2 VOB/B hafte. Der Kläger sei für seinen Vortrag darlegungs- und beweislastet, die geänderte Ausführung mit der Beklagten abgestimmt zu haben. Da ihm dies nicht gelungen sei, stehe sein Vorsatz fest.
19
Dieser Argumentation folgt der Senat nicht. Vorsatz erfordert das Bewusstsein der Rechtwidrigkeit oder Vertragswidrigkeit des Handelns. Für den Vorsatz des Klägers kann also nicht allein darauf abgestellt werden, dass er den Brandschutzgurt willentlich ausgeführt hat. Eine vorsätzliche Schadensherbeiführung setzt vielmehr voraus, dass dem Kläger die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung bewusst war. Voraussetzung eines solchen Bewusstseins ist wiederum, dass es die von dem Kläger im Einzelnen dargelegte Abrede zur geänderten Ausführung tatsächlich nicht gegeben hat. Hierfür ist die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig. Der Vorsatz ist eine der Beklagten günstige Tatsache, weil er zu einer verschärften Haftung führt. Nach der allgemeinen Regel der Darlegungs- und Beweislast muss jede Prozesspartei die ihr günstigen Tatsachen darlegen und beweisen. Auch der Vorsatz als Voraussetzung einer verschärften Haftung ist somit von der Beklagten darzulegen und zu beweisen (vgl. Weyer, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB, 4. Auflage, B § 13 Rz. 435; Wirth, in: Ingenstau/Korbion, VOB, 18. Auflage, B § 13 Abs. 7 Rz. 44).
20
b) Die Berufung macht geltend, dass das Landgericht zu Unrecht das Vorliegen eines wesentlichen, die Gebrauchstauglichkeit erheblich einschränkenden Mangels verneint habe. Tatsächlich lägen die Voraussetzungen der Haftung gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 1 VOB/B vor.
21
Nach den Feststellungen des Sachverständigen kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit nicht bejaht werden. Der Sachverständige hat festgestellt, dass der ausgeführte Brandschutzgurt und die in den Ausschreibungen vorgesehenen Brandschutzlamellen gleichwertig sind. Die Ausführungen der Beklagten, mit den Brandschutzlamellen solle ein „Abtropfen“ einer brennenden Fassade verhindert werden, damit die Fenster- und Türöffnungen als Rettungsweg benutzt werden könnten, hat der Sachverständige verneint. Der Sachverständige hat dargelegt (Gutachten vom 21. Oktober 2013, GA 355), dass die Brandabschottungen ‒ seien es Brandschutzlamellen oder der Brandriegel ‒ dazu dienen, aus einer Fassadenöffnung schlagende Flammen, die von einem Brand in den Innenräumen ausgehen, daran zu hindern, auf die Fassade überzugreifen. Dadurch soll die Ausbreitung eines Brandes über die Dämmstoffebene vermieden werden. Die Brandschutzlamellen könnten zudem dem von der Beklagten beschriebenen Zweck nicht genügen. Denn die Brandschutzlamellen wären nur unmittelbar oberhalb der Öffnungen in der Fassade anzubringen gewesen und sie hätten auch bündig mit der Fassade abgeschlossen. Einen Schutz vor herabtropfendem Material der an anderer Stelle brennenden Fassade könnten die Brandschutzlamellen damit ohnehin nicht bieten.
22
Hinzu kommt, dass die Beklagte das Gebäude nicht selbst nutzt. Es ist unstreitig, dass die Beklagte das Gebäude veräußert hat. Danach erschließt es sich nicht, warum für die Beklagte eine erhebliche Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit wegen des Einbaus eines Brandschutzriegels vorliegen sollte. Der vor ihr verfolgte Zweck lag darin, das Gebäude verkaufen zu können, ohne selbst Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt zu sein (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2012 ‒ VII ZR 209/11, Rz. 18, NJW 2013, 684). Dass die Beklagte Gewährleistungsansprüchen wegen des Brandschutzes ausgesetzt ist, macht sie nicht geltend. Auch ihr erst in zweiter Instanz erfolgter Hinweis auf eine angebliche Wertsteigerung im Falle der Ausführung der Brandschutzlamellen verfängt nicht. Denn die Beklagte trägt nichts dazu vor, dass sie die angebliche Wertsteigerung in einem höheren Verkaufspreis realisiert hätte. Zudem beruht die Annahme einer Wertsteigerung seitens der Beklagten auf ihrer Annahme, die Brandschutzlamellen wiesen einen höheren Sicherheitsstand auf. Gerade dies ist aber nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht der Fall. Schließlich hat der Geschäftsführer der Beklagten im Rahmen der Anhörung durch den Senat selbst ausgeführt, dass der Beklagten im Rahmen des Weiterverkaufs keine Nachteile wegen der Ausführung des Brandschutzriegels entstanden seien.
23
c) Die Berufung macht geltend, das Landgericht habe zu Unrecht einen Schadensersatzanspruch gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 2 VOB/B mit der Begründung verneint, dass diese Regelung nur den „großen Schadensersatz“ umfasse. Tatsächlich hafte der Kläger schon deshalb, weil die Werkleistung nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweise.
24
Dem folgt der Senat nicht. Die Beklagte übersieht, dass § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 2 VOB/B zusätzliche Haftungsvoraussetzungen aufstellt. Eine Haftung gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 2 VOB/B setzt also voraus, dass auch die Haftungsvoraussetzungen gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 1 VOB/B erfüllt sind (Weyer, a. a. O., B § 13 Rz. 418; Kohler, in: Beck´scher VOB-Kommentar, 3. Auflage, B § 13 Abs. 7 Rz. 165). Eine Haftung des Klägers kann entgegen der Ansicht der Berufung also nicht allein damit begründet werden, dass eine Abweichung von der vertraglichen vereinbarten Beschaffenheit vorliegen würde. Bei dieser Sichtweise wären zudem auch die einschränkenden Voraussetzungen gemäß § 13 Nr. 7 Abs. 3 Satz 1 VOB/B gegenstandslos.
25
d) Doch selbst wenn die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs vorliegen würden, wäre ein solcher ausgeschlossen. Die Beklagte hat das Gebäude veräußert und ihr drohen keine Gewährleistungsansprüche der Erwerberin. Der Geschäftsführer der Beklagten hat bei seiner Anhörung durch den Senat erklärt, dass die konkrete Ausführung des Brandschutzes der Wärmedämmfassade (ob mit Brandschutzriegel oder ‒lamellen) kein Thema gewesen sei. Die Erwerberin kann danach keinen Mangel daraus herleiten, dass ein Brandschutzriegel statt der ‒lamellen eingebaut worden ist, weil von einer vereinbarten Beschaffenheit abgewichen worden sei. Der Sachverständige hat zudem ausgeführt, dass die Ausführung mit Brandschutzgurt den Systemvorgaben des Herstellers der Wärmedämmverbundsystems entspricht und somit (objektiv) ein Mangel nicht vorliegt. Bei dieser Sachlage wäre es treuwidrig, wenn die Beklagte gleichwohl einen Schadensersatzanspruch durchsetzen könnte (BGH, Urt. v. 28.06.2007 ‒ VII ZR 81/06, NJW 2007, 2695; Urt. v. 28.06.2007 ‒ VII ZR 8/06, NJW 2007, 2697).
26
e) Jedenfalls wäre die Durchsetzung des von der Beklagten verfolgten Schadensersatzanspruchs entsprechend § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB unverhältnismäßig. Die Kosten für den nachträglichen Einbau der Brandschutzlamellen in Höhe von 134.444,90 EUR netto übersteigen den Werklohn in Höhe von 124.000,00 EUR netto, ohne dass dem ein greifbares Interesse der Beklagten an der Mängelbeseitigung gegenüberstünde. Der Verweis der Beklagten auf den intendierten Brandschutz überzeugt schon deshalb nicht, weil die Beklagte die Gebäude nicht selbst nutzt und es unstreitig veräußert hat.
27
f) Erfolg hat die Berufung wegen der vom Landgericht zugesprochenen Zinsen.
28
Durch die Übersendung der Schlussrechnung ist die Beklagte nicht in Verzug geraten. Wegen der Abweichung von der vertraglich vorgesehenen Ausführung (Brandschutzriegel statt Brandschutzlamellen) lag ein Mangel vor. Die Leistung hatte nicht die vereinbarte Beschaffenheit (§ 13 Nr. 1 VOB/B). Die Beweiswürdigung des Landgerichts wird von dem für die Abänderung der getroffenen Vereinbarung darlegungs- und beweisbelasteten Kläger nicht in erheblicher Weise angegriffen. Das Landgericht musste den als Anlage K 24 vorgelegten Schreiben des Zeugen Z nicht den Vorzug gegenüber den Zeugenaussagen einräumen. Dem Werklohnanspruch des Klägers stand somit ein Leistungsverweigerungsrecht der Beklagten gemäß § 320 BGB entgegen. Das Bestehen eines solchen Leistungsverweigerungsrechts, das von der Beklagten durch Mängelrüge (Schreiben vom 27. Februar 2009) ausgeübt worden ist, hindert den Verzug.
29
Auch besteht kein Anspruch auf Prozesszinsen gemäß § 291 BGB seit dem 12. Oktober 2009. Denn steht einer Forderung die Einrede gemäß § 320 BGB entgegen, so beginnt die Zinspflicht erst mit Wegfall der Einrede (Ernst, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflage, § 291 Rz. 10). Die Einrede gemäß § 320 BGB ist erst durch den Übergang vom Erfüllungs- zum Schadensersatzanspruch durch Aufrechnungseklärung im Schriftsatz vom 12. Juli 2013 (eingegangen am 16. Juli 2013) weggefallen. Prozesszinsen sind somit erst ab diesem Zeitpunkt geschuldet.
30
III. Berufung der Beklagten (zweiter Antrag)
31
Die Berufung wegen der von der Sparkasse geleisteten Zahlung hat keinen Erfolg. Eine Anspruchsgrundlage ist nicht ersichtlich. Vertragliche Ansprüche bestehen nicht. Dem Kläger ist es nicht vorzuwerfen, dass die Sparkasse trotz des Fehlens eines Überweisungsbeschlusses den Betrag (mehrfach) an ihn überwiesen hat. Auch ein Bereicherungsanspruch besteht nicht. Die Kläger hat zwar „etwas“ erlangt, dies aber durch Leistung der Sparkasse, nicht der Beklagten. Im Falle einer Zahlung auf Grund eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses verfolgt der Drittschuldner den Zweck, das Recht des Vollstreckungsgläubigers, die Zahlung an sich zu verlangen, zum Erlöschen bringen. Der Bereicherungsausgleich im Falle der Rechtsgrundlosigkeit der Zahlung findet danach im Verhältnis von Zuwendungsempfänger und Drittschuldner statt (BGH, Urt. v. 13.06.2002 ‒ IX ZR 242/01, BKR 2002, 687). Anders kann es sich auch nicht verhalten, wenn der Drittschuldner (hier: die Sparkasse) nach Erlass eines Pfändungsbeschlusses an den Vollstreckungsgläubiger (hier: den Kläger) zahlt, obwohl es an einer Überweisung der Forderung fehlt. Auch in diesem Fall muss der Vollstreckungsgläubiger davon ausgehen, dass die Zahlung aufgrund der Vollstreckungsmaßnahme erfolgt und nicht etwa eine Anweisung des Vollstreckungsschuldners (hier: der Beklagten) an den Drittschuldner Grund der Zahlung ist.
32
IV. Berufung des Klägers
33
1. Der Kläger wendet sich mit seiner Berufung gegen die Beweiswürdigung des Landgerichts, das eine vertragliche Vereinbarung über zusätzlichen Werklohn in Höhe von 2.350,00 EUR für die geänderte Ausführung des Tropfkantenprofils nicht als bewiesen angesehen hat. Er macht geltend, dass das Landgericht allein die Zeugenaussagen gewürdigt habe, es habe aber nicht die Anlage JK4 (Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 31. Mai 2010, GA 36) berücksichtigt. Darin habe die Beklagte für das Sockelprofil einen Betrag in Höhe von 2.796,50 EUR berücksichtigt. Zudem ergebe sich ein Auftrag aus dem handschriftlichen Vermerk, wie aus der Anlage K 25 (Anlage zum Schriftsatz des Klägers vom 11. November 2011, GA 176) ersichtlich sei.
34
Der Berufungsangriff hat Erfolg. Nach Vorlage der Anlage K 25 (Nachtragsangebot vom 19. November 2008 mit handschriftlicher Anmerkung des Projektleiters K, der abzüglich der Balkone einen Preis von 2.358,85 EUR ermittelt hat) ist die Erteilung des Auftrags durch den Zeugen K unstreitig geblieben. Die Beklagte hat auch nicht zu erklären vermocht, warum sie den Betrag in Höhe von 2.796,50 EUR (dies entspricht 2.350,00 EUR zzgl. 19 %) in ihrer Zahlungsaufstellung (JK 4) berücksichtigt hat, obwohl ein entsprechender Auftrag nicht erteilt worden sein soll. Dahinstehen kann, ob der Zeuge K zur Erteilung eines solchen Auftrags bevollmächtigt war. Denn auch wenn dies nicht der Fall war, so hat die Beklagte den in ihrem Namen erteilten Auftrag dadurch konkludent genehmigt, dass sie die 8. Abschlagsrechnung vom 05. Februar 2009 durch Verrechnung „bezahlt“ und die in dieser Abschlagsrechnung enthaltenen Mehrkosten für die geänderte Ausführung nicht beanstandet hat. Letztlich wäre aber auch in dem Fall, dass der Projektleiter K nicht bevollmächtigt war, ein Anspruch begründet. Der Sachverständige hat ausgeführt, dass das ausgeschriebene Tropfkantenprofil nicht geeignet war und durch das von dem Kläger ausgeführte Profil ersetzt werden musste (Seite 6 des Gutachtens vom 04. April 2013, GA 239). Danach ergibt sich jedenfalls ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Beklagte schuldet für die zur mangelfreien Fertigstellung des Bauwerks erforderliche Zusatzleistung gemäß § 2 Nr. 8 Abs. 3, §§ 677 ff., 670 BGB Aufwendungsersatz.
35
Danach ergibt sich folgende Berechnung:
36
Pauschalpreis 124.000,00 EURZulage Sockelprofil 2.350,00 EURZwischensumme 126.350,00 EUR./. Umlage 1,5 % 1.895,25 EURZwischensumme 124.454,75 EURUmsatzsteuer 19 % 23.646,40 EURZwischensumme 148.101,15 EUR./. Abschlagszahlungen 124.513,31 EURZwischensumme 23.588,02 EUR./. Gutschriften 2.444,65 EURRestbetrag 21.143,17 EUR.
37
38
2. Dieser Betrag ist aus den vorstehend genannten Gründen erst ab dem 16. Juli 2013 zu verzinsen. Der Berufungsantrag des Klägers zu den Verzugszinsen hat danach keinen Erfolg. Er kann auch nicht Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten beanspruchen. Die Beklagte ist wegen der Einrede gemäß § 320 BGB nicht in Verzug geraten.
39
V.
40
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO. Das Unterliegen des Klägers in zweiter Instanz ist so geringfügig (die Nebenforderungen sind für die Kostenentscheidung nicht zu berücksichtigen), dass der Beklagten die gesamten Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen waren.
41
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Voraussetzungen für besonderen Vollstreckungsschutz gemäß § 712 ZPO liegen nicht vor. Der Kläger legt bereits nicht dar, warum ihm durch die Zwangsvollstreckung ein nicht zu ersetzender Nachteil droht.
42
Die Revision war nicht zuzulassen, grundsätzliche Fragen standen nicht zur Entscheidung an.
43
Berufungsstreitwert: 131.887,62 EUR (Berufung des Klägers: 2.350,00 EUR, Berufung der Beklagten: 129.537,62 EUR).