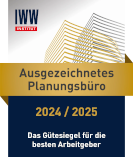17.06.2020 · IWW-Abrufnummer 216270
Oberlandesgericht Oldenburg: Urteil vom 20.08.2019 – 13 U 60/16
Diese Entscheidung enthält keinen zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz.
OBERLANDESGERICHT OLDENBURG
Im Namen des Volkes
Urteil
13 U 60/16
In dem Rechtsstreit
1. AA, Ort1,
2. BB, Ort1,
Kläger und Berufungskläger,
3. CC, Ort2,
4. DD, Ort3,
Kläger,
Prozessbevollmächtigte zu 1, 2, 3 und 4:
(...),
Geschäftszeichen: (...)
gegen
Rechtsanwalt EE, Ort3,
als Insolvenzverwalter über das Vermögen d. Herrn FF,
Beklagter und Berufungsbeklagter,
Prozessbevollmächtigte:
(...),
Geschäftszeichen: (...)
hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht (...), den Richter am Oberlandesgericht (...) und den Richter am Oberlandesgericht (...) auf die mündliche Verhandlung vom 25.06.2019 für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Kläger zu 1 und 2 wird das am 4. August 2016 verkündete Urteil des Einzelrichters der 2. Zivilkammer des Landgerichts Aurich unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels geändert und der Beklagte verurteilt,
an den Kläger zu 1 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 38,06/100 aus dem Betrag in Höhe von 2.300 € ergebenden Betrag in Höhe von 875,38 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 11.08.2015 zu zahlen,
an die Klägerin zu 2 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 40,20/100 aus dem Betrag in Höhe von 2.300 € ergebenden Betrag in Höhe von 924,60 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 11.08.2015 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, nach Ausführung der Mängelbeseitigungsarbeiten an den Kläger zu 1 die auf den Betrag von 875,38 € und an die Klägerin zu 2 die auf den Betrag von 924,60 € entfallende gesetzliche Umsatzsteuer zu erstatten.
Die Kosten der Berufung werden den Klägern zu je ½ auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Beide Parteien können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird zugelassen.
Gründe:
I.
Unter der Geschäftsnummer 2 O 802/08 des Landgerichts Aurich klagte der Architekt seine Honorarforderung ein. Das Verfahren wurde nach seinem Tod nicht weiter betrieben.
Mit der Klage über eine Summe von 145.455 € haben die Kläger die Kosten für die Erneuerung der Balkonanlage und der Markisenbefestigung geltend gemacht (140.995 € + 4.460 € = 145.455 €). Hierbei haben sie angenommen, dass der Sachverständige bezüglich der Markise in dem 1. Ergänzungsgutachten Lohnkosten von 2.160 € und Materialkosten von 2.300 € geschätzt habe.
Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang abgewiesen.
Wegen der Einzelheiten und der weiteren Feststellungen wird auf das Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Gegen das Urteil haben die Kläger zu 1 und 2 Berufung eingelegt, mit der sie ihr Klagebegehren unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens weiter verfolgen.
Die Kläger beantragen, das Urteil des Landgerichts Aurich vom 04.08.2016 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen,
1. an den Kläger zu 1 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 38,06/100 aus dem Betrag in Höhe von 145.455 € ergebenden Betrag in Höhe von 55.360,17 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen,
an die Klägerin zu 2 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 40,20/100 aus dem Betrag in Höhe von 145.455 € ergebenden Betrag in Höhe von 58.472,91 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen,
2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, nach Ausführung der Mängelbeseitigungsarbeiten die auf den im Klageantrag zu 1 benannten Schadenersatzbetrag entfallende gesetzliche Umsatzsteuer an die Kläger zu 1 und 2 zu erstatten.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Der Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.
Der Senat hat den Sachverständigen ergänzend angehört. Auf das Protokoll vom 25.06.2019 wird Bezug genommen.
II.
Die Berufung ist zulässig und hat in der Sache zu einem Teil Erfolg.
Ansprüche der Kläger wegen Schlechterfüllung des Architektenvertrags sind in Bezug auf den geltend gemachten Mangel an dem Treppengeländer (die Stäbe halten die vorgeschriebenen Abstände zum Teil nicht ein, sondern stehen zu weit auseinander) verjährt und können daher - auch nicht hilfsweise - einen Anspruch auf Zahlung des Klagebetrags nicht begründen.
Mangels schriftlichen Vertrags verjährt die Forderung aus dem Architektenvertrag nach § 648a Abs. 1 Nr. 2 BGB a.F.. Es gilt eine Frist von 5 Jahren. Die Frist beginnt mit Abnahme oder dann, wenn andere Umstände vorliegen, nach denen eine Erfüllung des Vertrags nicht mehr zu erwarten ist (BGH NJW 2011, 1124). Eine Abnahme der Architektenleistung hat wegen der Kündigung nicht stattgefunden. Nachdem der Architekt seine Tätigkeit für die Kläger mangels der von ihm geforderten Stellung einer Bürgschaft durch die Kläger aber eingestellt und die Kläger ihrerseits mit Datum vom 26.04.2004 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Herausgabe der Bau- und Architektenunterlagen gestellt hatten (Beiakte 2 O 802/08 LG Aurich, Bl. 58), war eine weitere Zusammenarbeit und Erfüllung des Architektenvertrags nicht mehr zu erwarten, so dass die Verjährungsfrist am 26.04.2004 zu laufen begann. Mit Zustellung des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren zur Geschäftsnummer 2 OH 18/09 des Landgerichts Aurich am 24.4.2009 (Beiakte 2 OH 18/09, Bl. 21 ), also knapp 5 Jahre später, wurde die Verjährung rechtzeitig vor Ablauf der 5-Jahres-Frist (26.4.2009) gehemmt.
Der zu Ziffer 1 des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren geltend gemachte Mangel bezüglich der Treppe ist durch das Gutachten des Sachverständigen GG vom 30.09.2010 festgestellt worden. Das weitere Verfahren betraf nur andere Mängel: Das 1. Ergänzungsgutachten des Sachverständigen GG vom 12.09.2014 betraf die Kosten einer eventuellen Durchfeuchtung der Wandfassade und die Anbringung der Markise, das 2. Ergänzungsgutachten vom 23.08.2016 befasste sich ausschließlich mit der Frage, ob Durchfeuchtungen am Wärmedämmverbundsystem tatsächlich vorlagen. Durch die Untersuchung dieser weiteren Mängel wurde die Hemmung der Verjährung bezüglich der Bezüglich dieses Mangels endete die durch das Selbständige Beweisverfahren bewirkte Hemmung der Verjährung bis zur Übersendung des ersten Gutachtens und Ablauf der gerichtlich gesetzten Stellungnahmefrist zum 09.12.2010 (Beiakte 2 OH 18/09, Bl. 59). Danach war die Treppenanlage nicht mehr Gegenstand des Beweisverfahrens. Aufgrund des während des Verfahrens eingetretenen Todes des Architekten FF am TT.MM.2010 trat allerdings eine Ablaufhemmung gemäß § 211 BGB ein. Die Frist nach § 211 BGB beginnt, wenn feststeht wer Erbe ist oder ‒ wie im vorliegenden Fall ‒ mit Bestellung eines legitimen Vertreters für den Nachlass nach §§ 1960 f. BGB (Schmidt-Ränsch in Erman, BGB, § 211 Rn 5), d.h. ab dem Zeitpunkt, an dem ein Gläubiger weiß, wer Prozessgegner ist. Der Nachlasspfleger ist am 08.11.2012 bestellt worden. Binnen der Frist von sechs Monaten nach seiner Bestellung ist die Verjährung nicht weiter gehemmt worden. Im Zeitpunkt der Einreichung der Klage im Mai 2015 war daher wegen der Treppenanlage Verjährung eingetreten.
Vorstehendes gilt auch für den zu Ziffer 2 des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren geltend gemachten Mangel hinsichtlich der Belegung der Balkone mit Bohlen aus Bangkirai-Holz. Zu der konkreten Mangelbehauptung, die Bohlen seien bis an die Hauswand verlegt, eine kontrollierte Entwässerung fehle, so dass Regenwasser von den Balkonen der oberen Geschosse über die Stahlkonstruktion und die Hauswände herablaufe und auf die unteren Balkone tropfe, was zu Verschmutzungen an den Außenwänden und der Stahlkonstruktion führe, ist Beweis erhoben worden durch Einholung des ersten Sachverständigengutachtens. Der Sachverständige hat darin die Behauptungen der Kläger in vollem Umfang bestätigt, indem er festgestellt hat, dass das Wasser unkontrolliert von den Balkonen der oberen Geschosse durch die Spalten des Holzbohlenbelags über die Stahlkonstruktion auf die unteren Balkone läuft und bereits Verschmutzungen an den Außenwänden des Hauses und an der Stahlkonstruktion vorhanden waren (Seite 19 des Gutachtens vom 30.09.2010). Zur fachgerechten Entwässerung hätte, so der Sachverständige, eine Blechwanne unterhalb der jeweiligen Balkonfläche angebracht werden müssen, um Abtropfwasser abzufangen und abzuleiten und ein Spritzschutz an den Wänden, um diese vor dem von oben auf die Bangkirai-Bohlen fallenden Regenwasser zu schützen. Damit war der geltend gemachte konstruktive Mangel im Selbständigen Beweisverfahren geklärt. Die weiteren Ergänzungsgutachten befassten sich ausschließlich mit der Frage, ob an den Befestigungspunkten, an denen die Balkonkonstruktion angebracht worden ist, Wasser in das Wärmeverbundsystem und die dahinter liegende Wand eindringen sowie mit der weiteren Frage der Anbringung der Markise am Dach. Die Balkonkonstruktion wurde mittels Stahlprofilen durch das Wärmeverbundsystem an der Massivbaukonstruktion befestigt, das Wärmeverbundsystem wurde um diese Stahlkonsolen herum erstellt. Bei der Frage, ob diese Ausführung fachgerecht war oder ob dadurch Wasser hinter die Wärmedämmung eintreten konnte, handelt es sich indessen um einen anderen Mangel als die Regenwasserentwässerung der Balkone selbst. Der erste Komplex betrifft die Anbringung des Stahlgerüsts der Balkonanlage an die Hauswand und die dadurch möglicherweise entstandenen Schäden an dem Wärmeverbundsystem, der zweite die Belegung der Balkone mit Bohlen und ihre Entwässerung. Dass die Balkonflächen selbst entwässert werden müssen ‒ damit das Regenwasser nicht auf die darunter liegenden Balkone und das tragende Gerüst abtropft, ist unabhängig davon, wie die Balkonkonstruktion fachgerecht an der Hauswand befestigt werden muss, ohne die Wärmedämmung zu beschädigen. Maßnahmen zur weiteren Hemmung der Verjährung betreffend die Mängel der Entwässerung der Balkone sind nicht erfolgt. Im Zeitpunkt der Einreichung der Klage im Mai 2015 waren eventuelle Ansprüche verjährt. Es kommt daher nicht auf die Höhe eventueller Reinigungskosten an. Der Sachverständige ist im Termin am 25.06.2019, wie der Senat betont hat, zu ihrer Höhe nur vorbehaltlich der Verjährungsproblematik angehört worden sowie zur Führung von Vergleichsgesprächen.
Ob und ggf. in welcher Höhe wegen der Kosten der Schöck-Iso-Körbe ein Ersatzanspruch gegen den Architekten begründet ist, kann offen bleiben. Denn ein Anspruch ist nicht beziffert worden. Die Klageforderung beruht auf der Kostenschätzung des Sachverständigen für den Ab- und Aufbau der gesamten Balkonanlage, die aus vorstehenden Gründen nicht geschuldet ist. Die Rechnung der Fa. JJ ist auch nach der Erörterung dieser Schadensposition in der Verhandlung vom 25.06.2019 seitens der Kläger nicht mehr vorgelegt worden.
Die Berufung der Kläger hat Erfolg in Bezug auf die Anbringung der Markise. Nach den Feststellungen im Selbständigen Beweisverfahren hätte die Markise an der im Plan vorgesehenen Stelle angebracht werden können. Allerdings war verabsäumt worden, vor dem Anbringen der Fassadenplatten eine nach außen führende Haltekonstruktion anzubringen, so dass die Markise später angebracht werden konnte, ohne dass die Fassadenplatten erst wieder abgebaut werden mussten. Zwar hat der Sachverständige in seinem 1. Ergänzungsgutachten noch Bedenken geäußert, ob die Anbringung der Fassadenverkleidung ohne Durchlässe ein technischer Mangel sei, da u. U. noch Nacharbeiten an den durchgeführten Befestigungspunkten erforderlich geworden wären, weil es bei Markisen keine normmäßig festgelegten Befestigungen gebe und man z.B. bei den Aufnahmehaltern die Abstände der unteren und oberen Befestigungspunkte jeweils individuell herstellen müsste, so dass es aus technischer Sicht nicht unbedingt angezeigt gewesen wäre, die Befestigung auf Seiten der Wand schon vorab durch die Fassadenverkleidung zu führen. Daran hat der Sachverständige aber in seiner persönlichen Anhörung nicht mehr festgehalten und angegeben, der Bauherr sei später lediglich in der Auswahl der Markisen eingeschränkt, die zu den bereits nach außen geführten Befestigungspunkten passen müssten. War die Markise, wie vom Kläger zu 1 bei der Anhörung des Sachverständigen vorgetragen, sogar schon vorhanden, wäre die Durchführung der passenden Befestigungen kein Problem gewesen. Das Unterlassen der erforderlichen Koordination der Arbeiten stellte eine Pflichtverletzung des Architektenvertrags dar. Es wäre Aufgabe des Architekten gewesen, die Koordination der Arbeiten bei der Bauausführung so vorzunehmen, dass die Markise an den vorgesehenen Punkten angebracht werden konnte, ohne dass man die Fassadenverkleidung wieder abbauen musste. Der dadurch entstandene zusätzliche Aufwand stellt einen ersatzfähigen Schaden der Kläger dar. Der Höhe nach beträgt er entsprechend der Berechnung des Sachverständigen im 1. Ergänzungsgutachten 2.300 € netto. Die Angaben des Sachverständigen sind nachvollziehbar. Für die Öffnung und das Verschließen können einschließlich Gerüstauf- und abbau rund 48 Stunden kalkuliert werden, was bei einem Stundenlohn von 45 € auf der Insel zu 2.160 € Lohn und zuzüglich Material zu einer Summe von insgesamt 2.300 € netto führt (...). Die Kläger können damit einen Vorschuss von 2.300 € für die Mängelbeseitigung verlangen. Dieser Betrag ist entsprechend der Höhe ihres Miteigentumanteils gemäß Klageantrag auf die Kläger zu 1 und 2 zu verteilen.
Der Feststellungsantrag wegen der auf die nach Durchführung der Arbeiten anfallende Umsatzsteuer ist in Bezug auf den o.g. Betrag begründet.
Der Zinsanspruch ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges.
Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 92 Abs. 2 Nr. 1, 708 Nr. 10. 711 ZPO.
Der Senat lässt die Revision gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO im Hinblick auf die Beendigung der Hemmung der Verjährung bei Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens zu. Dass die Voraussetzung eines Gewährleistungsanspruchs für jeden Mangel getrennt zu prüfen ist und dementsprechend auch die Verjährungsfristen getrennt laufen, ist im dem Grunde nach nicht streitig. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall der Einleitung eines mehrere selbstständige Mängel betreffenden Beweisverfahrens hat grundsätzliche Bedeutung, da von der Entscheidung abhängt, ob der Bauherr/Auftraggeber ohne Rechtsnachteil den Abschluss des Selbständigen Beweisverfahrens abwarten kann oder seine Gewährleistungsansprüche wegen jeden einzelnen Mangels in nichtverjährter Zeit geltend machen muss.
Im Namen des Volkes
Urteil
13 U 60/16
2 O 385/15 Landgericht Aurich
Verkündet am 20.08.2019
In dem Rechtsstreit
1. AA, Ort1,
2. BB, Ort1,
Kläger und Berufungskläger,
3. CC, Ort2,
4. DD, Ort3,
Kläger,
Prozessbevollmächtigte zu 1, 2, 3 und 4:
(...),
Geschäftszeichen: (...)
gegen
Rechtsanwalt EE, Ort3,
als Insolvenzverwalter über das Vermögen d. Herrn FF,
Beklagter und Berufungsbeklagter,
Prozessbevollmächtigte:
(...),
Geschäftszeichen: (...)
hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht (...), den Richter am Oberlandesgericht (...) und den Richter am Oberlandesgericht (...) auf die mündliche Verhandlung vom 25.06.2019 für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Kläger zu 1 und 2 wird das am 4. August 2016 verkündete Urteil des Einzelrichters der 2. Zivilkammer des Landgerichts Aurich unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels geändert und der Beklagte verurteilt,
an den Kläger zu 1 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 38,06/100 aus dem Betrag in Höhe von 2.300 € ergebenden Betrag in Höhe von 875,38 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 11.08.2015 zu zahlen,
an die Klägerin zu 2 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 40,20/100 aus dem Betrag in Höhe von 2.300 € ergebenden Betrag in Höhe von 924,60 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 11.08.2015 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, nach Ausführung der Mängelbeseitigungsarbeiten an den Kläger zu 1 die auf den Betrag von 875,38 € und an die Klägerin zu 2 die auf den Betrag von 924,60 € entfallende gesetzliche Umsatzsteuer zu erstatten.
Die Kosten der Berufung werden den Klägern zu je ½ auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Beide Parteien können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird zugelassen.
Gründe:
I.
Der Beklagte ist Nachlassverwalter des am TT.MM.2010 verstorbenen Architekten FF. Die gesetzlichen Erben haben das Erbe ausgeschlagen. Die Kläger sind Eigentümer zu Bruchteilen eines Hauses in Ort1, das sie aufwändig saniert und umgebaut haben. Wegen verschiedener Mängel haben sie mehrere Prozesse gegen Handwerker mit Streitverkündung gegenüber dem Architekten geführt. Der Architekt FF war während des Bauvorhabens eingeschaltet worden. Er war nicht von Anfang an mit den Planungen betraut, sondern erst ab Leistungsphase 5. Während der Baus kam es zu Differenzen mit den Bauherrn. Der Forderung des Architekten auf Stellung einer Bankbürgschaft als Sicherheit für seine Honorarforderung nach § 648a BGB a.F. kamen die Kläger nicht nach, woraufhin der Architekt im April 2004 den Vertrag kündigte, das Bauvorhaben wurde ohne ihn fertiggestellt.
Zu der Geschäftsnummer 2 OH 18/09 des Landgerichts Aurich war ein Selbständiges Beweisverfahren zwischen den jetzigen Klägern und dem Architekten anhängig, in dessen Verlauf der Architekt im Oktober 2010 verstarb und das später gegen den Beklagten als dessen Nachlassverwalter fortgeführt wurde. Mit Antrag vom 06.04.2010 begehrten die Kläger in diesem Beweisverfahren die Feststellung folgender Mängel:
- Das Treppengeländer im Treppenhaus weise an den Podesten Stababstände von 148 mm, 139 mm und 156 mm auf und überschreite damit den zulässigen Abstand von 120 mm,
- Die Balkone seien mit Bangkirai-Holzbohlen bis an die Hauswand belegt, eine kontrollierte Entwässerung fehle, so dass Regenwasser unkontrolliert über die Stahlkonstruktion und die Hauswand herablaufe, was zu Verschmutzungen an den Außenwänden und der Stahlkonstruktion führe,
- Die Balkone seien nicht an den ursprünglich für die Befestigung geplanten und eingebauten Konsolen befestigt worden, statt dessen sei das Wärmedämmverbundsystem an ungeplanten Punkten aufgeschnitten und die Balkonkonstruktion hier befestigt worden, wobei an den Befestigungspunkten Wasser in das Wärmedämmverbundsystem eindringe und die dahinter liegende Außenwand durchfeuchte,
- Die im Pultdach liegende Befestigungskonstruktion für die geplante Dachauskragung und Markisenbefestigung sei ungeeignet.
Mit der Klage über eine Summe von 145.455 € haben die Kläger die Kosten für die Erneuerung der Balkonanlage und der Markisenbefestigung geltend gemacht (140.995 € + 4.460 € = 145.455 €). Hierbei haben sie angenommen, dass der Sachverständige bezüglich der Markise in dem 1. Ergänzungsgutachten Lohnkosten von 2.160 € und Materialkosten von 2.300 € geschätzt habe.
Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang abgewiesen.
Wegen der Einzelheiten und der weiteren Feststellungen wird auf das Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Gegen das Urteil haben die Kläger zu 1 und 2 Berufung eingelegt, mit der sie ihr Klagebegehren unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens weiter verfolgen.
Die Kläger beantragen, das Urteil des Landgerichts Aurich vom 04.08.2016 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen,
1. an den Kläger zu 1 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 38,06/100 aus dem Betrag in Höhe von 145.455 € ergebenden Betrag in Höhe von 55.360,17 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen,
an die Klägerin zu 2 den sich aus dem Bruchteil in Höhe von 40,20/100 aus dem Betrag in Höhe von 145.455 € ergebenden Betrag in Höhe von 58.472,91 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen,
2. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, nach Ausführung der Mängelbeseitigungsarbeiten die auf den im Klageantrag zu 1 benannten Schadenersatzbetrag entfallende gesetzliche Umsatzsteuer an die Kläger zu 1 und 2 zu erstatten.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Der Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.
Der Senat hat den Sachverständigen ergänzend angehört. Auf das Protokoll vom 25.06.2019 wird Bezug genommen.
II.
Die Berufung ist zulässig und hat in der Sache zu einem Teil Erfolg.
Ansprüche der Kläger wegen Schlechterfüllung des Architektenvertrags sind in Bezug auf den geltend gemachten Mangel an dem Treppengeländer (die Stäbe halten die vorgeschriebenen Abstände zum Teil nicht ein, sondern stehen zu weit auseinander) verjährt und können daher - auch nicht hilfsweise - einen Anspruch auf Zahlung des Klagebetrags nicht begründen.
Mangels schriftlichen Vertrags verjährt die Forderung aus dem Architektenvertrag nach § 648a Abs. 1 Nr. 2 BGB a.F.. Es gilt eine Frist von 5 Jahren. Die Frist beginnt mit Abnahme oder dann, wenn andere Umstände vorliegen, nach denen eine Erfüllung des Vertrags nicht mehr zu erwarten ist (BGH NJW 2011, 1124). Eine Abnahme der Architektenleistung hat wegen der Kündigung nicht stattgefunden. Nachdem der Architekt seine Tätigkeit für die Kläger mangels der von ihm geforderten Stellung einer Bürgschaft durch die Kläger aber eingestellt und die Kläger ihrerseits mit Datum vom 26.04.2004 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Herausgabe der Bau- und Architektenunterlagen gestellt hatten (Beiakte 2 O 802/08 LG Aurich, Bl. 58), war eine weitere Zusammenarbeit und Erfüllung des Architektenvertrags nicht mehr zu erwarten, so dass die Verjährungsfrist am 26.04.2004 zu laufen begann. Mit Zustellung des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren zur Geschäftsnummer 2 OH 18/09 des Landgerichts Aurich am 24.4.2009 (Beiakte 2 OH 18/09, Bl. 21 ), also knapp 5 Jahre später, wurde die Verjährung rechtzeitig vor Ablauf der 5-Jahres-Frist (26.4.2009) gehemmt.
Werden ‒ wie im vorliegenden Fall - unterschiedliche Mängel im Selbständigen Beweisverfahren geltend gemacht, endet die Hemmung für jeden Mangel gesondert. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Mängel später gemeinsam eingeklagt werden sollen (Schmidt-Ränsch in Erman, BGB, 15. Aufl., § 204, Rn. 45; OLG Hamm NJW-Spezial 2009, 205, 206; Lakis in jurisPK BGB, § 204 Rn. 5). Wird ein Mangel durch das Gutachten im Selbständigen Beweisverfahren festgestellt und werden sodann weitere Gutachten eingeholt, die nur noch andere Mängel betreffen, endet die Hemmung nach dem ersten Gutachten bezüglich des festgestellten Mangels (vgl. OLG Hamm a.a.O; OLG München, NZBau 2007, 335).
Der zu Ziffer 1 des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren geltend gemachte Mangel bezüglich der Treppe ist durch das Gutachten des Sachverständigen GG vom 30.09.2010 festgestellt worden. Das weitere Verfahren betraf nur andere Mängel: Das 1. Ergänzungsgutachten des Sachverständigen GG vom 12.09.2014 betraf die Kosten einer eventuellen Durchfeuchtung der Wandfassade und die Anbringung der Markise, das 2. Ergänzungsgutachten vom 23.08.2016 befasste sich ausschließlich mit der Frage, ob Durchfeuchtungen am Wärmedämmverbundsystem tatsächlich vorlagen. Durch die Untersuchung dieser weiteren Mängel wurde die Hemmung der Verjährung bezüglich der Bezüglich dieses Mangels endete die durch das Selbständige Beweisverfahren bewirkte Hemmung der Verjährung bis zur Übersendung des ersten Gutachtens und Ablauf der gerichtlich gesetzten Stellungnahmefrist zum 09.12.2010 (Beiakte 2 OH 18/09, Bl. 59). Danach war die Treppenanlage nicht mehr Gegenstand des Beweisverfahrens. Aufgrund des während des Verfahrens eingetretenen Todes des Architekten FF am TT.MM.2010 trat allerdings eine Ablaufhemmung gemäß § 211 BGB ein. Die Frist nach § 211 BGB beginnt, wenn feststeht wer Erbe ist oder ‒ wie im vorliegenden Fall ‒ mit Bestellung eines legitimen Vertreters für den Nachlass nach §§ 1960 f. BGB (Schmidt-Ränsch in Erman, BGB, § 211 Rn 5), d.h. ab dem Zeitpunkt, an dem ein Gläubiger weiß, wer Prozessgegner ist. Der Nachlasspfleger ist am 08.11.2012 bestellt worden. Binnen der Frist von sechs Monaten nach seiner Bestellung ist die Verjährung nicht weiter gehemmt worden. Im Zeitpunkt der Einreichung der Klage im Mai 2015 war daher wegen der Treppenanlage Verjährung eingetreten.
Vorstehendes gilt auch für den zu Ziffer 2 des Antrags im Selbständigen Beweisverfahren geltend gemachten Mangel hinsichtlich der Belegung der Balkone mit Bohlen aus Bangkirai-Holz. Zu der konkreten Mangelbehauptung, die Bohlen seien bis an die Hauswand verlegt, eine kontrollierte Entwässerung fehle, so dass Regenwasser von den Balkonen der oberen Geschosse über die Stahlkonstruktion und die Hauswände herablaufe und auf die unteren Balkone tropfe, was zu Verschmutzungen an den Außenwänden und der Stahlkonstruktion führe, ist Beweis erhoben worden durch Einholung des ersten Sachverständigengutachtens. Der Sachverständige hat darin die Behauptungen der Kläger in vollem Umfang bestätigt, indem er festgestellt hat, dass das Wasser unkontrolliert von den Balkonen der oberen Geschosse durch die Spalten des Holzbohlenbelags über die Stahlkonstruktion auf die unteren Balkone läuft und bereits Verschmutzungen an den Außenwänden des Hauses und an der Stahlkonstruktion vorhanden waren (Seite 19 des Gutachtens vom 30.09.2010). Zur fachgerechten Entwässerung hätte, so der Sachverständige, eine Blechwanne unterhalb der jeweiligen Balkonfläche angebracht werden müssen, um Abtropfwasser abzufangen und abzuleiten und ein Spritzschutz an den Wänden, um diese vor dem von oben auf die Bangkirai-Bohlen fallenden Regenwasser zu schützen. Damit war der geltend gemachte konstruktive Mangel im Selbständigen Beweisverfahren geklärt. Die weiteren Ergänzungsgutachten befassten sich ausschließlich mit der Frage, ob an den Befestigungspunkten, an denen die Balkonkonstruktion angebracht worden ist, Wasser in das Wärmeverbundsystem und die dahinter liegende Wand eindringen sowie mit der weiteren Frage der Anbringung der Markise am Dach. Die Balkonkonstruktion wurde mittels Stahlprofilen durch das Wärmeverbundsystem an der Massivbaukonstruktion befestigt, das Wärmeverbundsystem wurde um diese Stahlkonsolen herum erstellt. Bei der Frage, ob diese Ausführung fachgerecht war oder ob dadurch Wasser hinter die Wärmedämmung eintreten konnte, handelt es sich indessen um einen anderen Mangel als die Regenwasserentwässerung der Balkone selbst. Der erste Komplex betrifft die Anbringung des Stahlgerüsts der Balkonanlage an die Hauswand und die dadurch möglicherweise entstandenen Schäden an dem Wärmeverbundsystem, der zweite die Belegung der Balkone mit Bohlen und ihre Entwässerung. Dass die Balkonflächen selbst entwässert werden müssen ‒ damit das Regenwasser nicht auf die darunter liegenden Balkone und das tragende Gerüst abtropft, ist unabhängig davon, wie die Balkonkonstruktion fachgerecht an der Hauswand befestigt werden muss, ohne die Wärmedämmung zu beschädigen. Maßnahmen zur weiteren Hemmung der Verjährung betreffend die Mängel der Entwässerung der Balkone sind nicht erfolgt. Im Zeitpunkt der Einreichung der Klage im Mai 2015 waren eventuelle Ansprüche verjährt. Es kommt daher nicht auf die Höhe eventueller Reinigungskosten an. Der Sachverständige ist im Termin am 25.06.2019, wie der Senat betont hat, zu ihrer Höhe nur vorbehaltlich der Verjährungsproblematik angehört worden sowie zur Führung von Vergleichsgesprächen.
Die Berufung hat auch im Hinblick auf die Ausführung der Balkonanlage als freitragende Konstruktion keinen Erfolg. Die Kläger haben nicht dargelegt, dass die Ausführung als freitragende Konstruktion vertragswidrig war und damit einen Mangel darstellen könnte, der zu einer Haftung des Architekten führte. Ursprünglich war zwar eine andere Konstruktion vorgesehen, nämlich eine Befestigung der Balkonanlage mittels Schöck-Iso-Körben an die Hauswand anstelle der freitragenden, vor die Wand gestellten Anlage. Die Berechnung des Sachverständigen im Selbständigen Beweisverfahren betrifft zwar die Kosten, die anfallen würden, wenn man die vorhandene Anlage wieder entfernte und eine neue, der ursprünglichen Planung entsprechende Konstruktion anbringen würde. Eine solche Maßnahme wäre aber nur geschuldet, wenn die Änderung der Konstruktion den Klägern nicht zugerechnet werden könnte. Dies haben die Kläger nicht dargetan. Seitens des Beklagten bzw. durch den verstorbenen Architekten selbst ist mehrfach vorgetragen worden, ihm sei schleierhaft, warum die Kläger und die Fa. HH abweichend vom alten Plan eine andere Ausführung gewählt hätten. Dazu haben die Kläger nichts konkret vorgetragen.
Die Darlegungslast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Auftraggeber. Der Senat kann auch nicht nachvollziehen, dass eine derart gravierende Änderung der Bauausführung ohne Beteiligung der Kläger als Auftraggeber vorgenommen worden sein sollte. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Firma des Ehemanns der Klägerin CC das Material für die Balkonkonstruktion geliefert hat. Die Kläger haben sich mit der Klageforderung der Berechnung des Sachverständigen angeschlossen. Aus ihr folgt aber nicht, dass die Beklagten einen Rechtsanspruch auf Abbruch und Neuerrichtung nach den ursprünglichen Planungsunterlagen haben, weil die Abweichung einen Mangel der Ausführung darstellt. Der verstorbene Architekt hat im Selbständigen Beweisverfahren zu der Kostenermittlung des Sachverständigen GG zutreffend darauf hingewiesen, dass es sich dabei um nichts weniger als um die Erneuerung sämtlicher Balkone handele, obwohl eine solche Kostenermittlung nach der Beweisfrage überhaupt nicht notwendig war (Beiakte 2 OH 18/09, Bl. 95). Denn die Kläger haben in ihrem Antrag auf Selbständige Beweissicherung überhaupt nicht beanstandet, dass die Balkonanlage - vertragswidrig - als selbsttragende errichtet worden ist. Der Beweisantrag zu 3 ging lediglich dahin festzustellen, dass die Balkonanlage nicht an den eigentlich vorgesehenen Punkten angebracht worden sei und man stattdessen das Wärmeverbundsystem an ungeplanten Punkten aufgeschnitten habe, was zur Folge habe, dass hier Wasser eindringen und die Wand hinter den Wärmedämmplatten durchfeuchten könne. Hierdurch könne man, so der Antrag zu 3, auch die Befestigungspunkte bei Wartungsarbeiten nicht ohne umfangreiche Demontagearbeiten an den Holzbelägen erreichen. Der behauptete Mangel lag mithin nicht in der Abweichung der Istbeschaffenheit von einer anderen vertraglich vereinbarten Ausführung, sondern lediglich darin, dass die tatsächlich aufgestellte ‒ freitragende ‒ Konstruktion nicht fachgerecht ohne Beschädigung des Wärmeverbundsystems an das Mauerwerk befestigt wurde. Dies spricht dafür, dass die geänderte Ausführung von den Klägern hingenommen und nachträglich genehmigt wurde, sie jedoch auf ihren fachgerechten Anschluss pochen wollten. Jedenfalls stellt es ein widersprüchliches Verhalten der Kläger dar, wenn sie zunächst handwerkliche Mängel der ausgeführten Konstruktion rügen, dann aber, nachdem der Sachverständige festgestellt hat, dass solche nicht vorliegen (Zitat aus dem Gutachten: „Insofern ist auch zurzeit hier kein handwerklicher Fehler erkennbar - allerdings eine andere Ausführung als in der Zeichnung“ (...)), behaupten, die Änderung der Anlage sei vertragswidrig gewesen. Dass die Kläger ihre Schadenersatzansprüche nicht auf die Veränderung der Anlage selbst in dem Sinne stützen wollten, dass die Kosten für den Abbau und den Neubau nach der ersten Planung verlangt werden, ergibt sich auch aus den Angaben des Klägers zu 1 in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 25.06.2019. Danach hätten sie, die Kläger, den Schaden darin gesehen, dass sie die Schöck-Iso-Körbe bezahlt hätten, die in der Rechnung des Bauunternehmers JJ enthalten gewesen seien und diese Körbe „unnutz“ gewesen seien, weil sie nicht entsprechend der ursprünglich geplanten Ausführung verwendet worden seien, da die freitragende Anlage nicht an ihnen, sondern an anderen Punkten befestigt worden sei. Diese Darstellung entspricht auch der Beweisfrage 1 im Antrag der Kläger im Selbständigen Beweisverfahren, in der als Mangel (lediglich) gerügt wird, dass die Balkonanlage nicht an den ursprünglich für die Befestigung geplanten Konsolen befestigt worden sei.
Ob und ggf. in welcher Höhe wegen der Kosten der Schöck-Iso-Körbe ein Ersatzanspruch gegen den Architekten begründet ist, kann offen bleiben. Denn ein Anspruch ist nicht beziffert worden. Die Klageforderung beruht auf der Kostenschätzung des Sachverständigen für den Ab- und Aufbau der gesamten Balkonanlage, die aus vorstehenden Gründen nicht geschuldet ist. Die Rechnung der Fa. JJ ist auch nach der Erörterung dieser Schadensposition in der Verhandlung vom 25.06.2019 seitens der Kläger nicht mehr vorgelegt worden.
Die Berufung der Kläger hat Erfolg in Bezug auf die Anbringung der Markise. Nach den Feststellungen im Selbständigen Beweisverfahren hätte die Markise an der im Plan vorgesehenen Stelle angebracht werden können. Allerdings war verabsäumt worden, vor dem Anbringen der Fassadenplatten eine nach außen führende Haltekonstruktion anzubringen, so dass die Markise später angebracht werden konnte, ohne dass die Fassadenplatten erst wieder abgebaut werden mussten. Zwar hat der Sachverständige in seinem 1. Ergänzungsgutachten noch Bedenken geäußert, ob die Anbringung der Fassadenverkleidung ohne Durchlässe ein technischer Mangel sei, da u. U. noch Nacharbeiten an den durchgeführten Befestigungspunkten erforderlich geworden wären, weil es bei Markisen keine normmäßig festgelegten Befestigungen gebe und man z.B. bei den Aufnahmehaltern die Abstände der unteren und oberen Befestigungspunkte jeweils individuell herstellen müsste, so dass es aus technischer Sicht nicht unbedingt angezeigt gewesen wäre, die Befestigung auf Seiten der Wand schon vorab durch die Fassadenverkleidung zu führen. Daran hat der Sachverständige aber in seiner persönlichen Anhörung nicht mehr festgehalten und angegeben, der Bauherr sei später lediglich in der Auswahl der Markisen eingeschränkt, die zu den bereits nach außen geführten Befestigungspunkten passen müssten. War die Markise, wie vom Kläger zu 1 bei der Anhörung des Sachverständigen vorgetragen, sogar schon vorhanden, wäre die Durchführung der passenden Befestigungen kein Problem gewesen. Das Unterlassen der erforderlichen Koordination der Arbeiten stellte eine Pflichtverletzung des Architektenvertrags dar. Es wäre Aufgabe des Architekten gewesen, die Koordination der Arbeiten bei der Bauausführung so vorzunehmen, dass die Markise an den vorgesehenen Punkten angebracht werden konnte, ohne dass man die Fassadenverkleidung wieder abbauen musste. Der dadurch entstandene zusätzliche Aufwand stellt einen ersatzfähigen Schaden der Kläger dar. Der Höhe nach beträgt er entsprechend der Berechnung des Sachverständigen im 1. Ergänzungsgutachten 2.300 € netto. Die Angaben des Sachverständigen sind nachvollziehbar. Für die Öffnung und das Verschließen können einschließlich Gerüstauf- und abbau rund 48 Stunden kalkuliert werden, was bei einem Stundenlohn von 45 € auf der Insel zu 2.160 € Lohn und zuzüglich Material zu einer Summe von insgesamt 2.300 € netto führt (...). Die Kläger können damit einen Vorschuss von 2.300 € für die Mängelbeseitigung verlangen. Dieser Betrag ist entsprechend der Höhe ihres Miteigentumanteils gemäß Klageantrag auf die Kläger zu 1 und 2 zu verteilen.
Der Feststellungsantrag wegen der auf die nach Durchführung der Arbeiten anfallende Umsatzsteuer ist in Bezug auf den o.g. Betrag begründet.
Der Zinsanspruch ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges.
Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 92 Abs. 2 Nr. 1, 708 Nr. 10. 711 ZPO.
Der Senat lässt die Revision gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO im Hinblick auf die Beendigung der Hemmung der Verjährung bei Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens zu. Dass die Voraussetzung eines Gewährleistungsanspruchs für jeden Mangel getrennt zu prüfen ist und dementsprechend auch die Verjährungsfristen getrennt laufen, ist im dem Grunde nach nicht streitig. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall der Einleitung eines mehrere selbstständige Mängel betreffenden Beweisverfahrens hat grundsätzliche Bedeutung, da von der Entscheidung abhängt, ob der Bauherr/Auftraggeber ohne Rechtsnachteil den Abschluss des Selbständigen Beweisverfahrens abwarten kann oder seine Gewährleistungsansprüche wegen jeden einzelnen Mangels in nichtverjährter Zeit geltend machen muss.