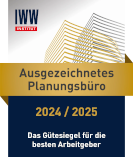18.12.2014 · IWW-Abrufnummer 143529
Oberlandesgericht Stuttgart: Urteil vom 15.04.2014 – 10 U 130/13
1.
Bei der Auslegung des vertraglich versprochenen Werks (hier: Bodenversiegelung eines Gussaphalt-Bodens) kommt neben dem Wortlaut der Funktionstauglichkeit für den auch dem Unternehmer bekannten Einsatzzweck eine maßgebliche Bedeutung zu.
2.
Der Auftraggeber darf im Rahmen der Selbstvornahme nach § 637 BGB auch eine vom ursprünglichen Vertragsumfang nicht erfasste Art der Bodenbelegung (hier: statt Oberflächenversiegelung Fliesen) vornehmen lassen, wenn aufgrund der mangelhaften Ausführung der geschuldeten Versiegelung eine erneute Versiegelung nur mit erheblichen, nicht zumutbaren Risiken möglich wäre.
Oberlandesgericht Stuttgart
Urt. v. 15.04.2014
Az.: 10 U 130/13
Im Rechtsstreit
A GmbH
- Klägerin / Widerbeklagte / Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigte:
gegen
B GmbH & Co.KG, Bauunternehmen
- Beklagte / Widerklägerin / Berufungsbeklagte -
Prozessbevollmächtigte:
Streithelferin / Berufungsklägerin:
Prozessbevollmächtigte:
wegen Forderung aus Werkvertrag
hat der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2014 unter Mitwirkung von
Richter am Oberlandesgericht
Richterin am Oberlandesgericht
Richter am Landgericht
für Recht erkannt:
Tenor:
1.
Auf die Berufung der Beklagten hin wird das Urteil des Landgerichts Stuttgart in Tenor Ziff. 2 wie folgt abgeändert:
Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte 11.128,80 € zu bezahlen zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 09.04.2013.
Die Klägerin wird des Weiteren verurteilt, die Beklagte von einer weitergehenden Forderung der Streithelferin aus dem Einbau einer für Bäckerei, Konditorei und Café ungeeigneten Beschichtung in Höhe von 5.723,34 € freizustellen.
Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
2.
Die darüber hinausgehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.
3.
Die Berufung der Klägerin wird in Höhe von 5.537,81 € verworfen, im Übrigen zurückgewiesen.
4.
Die Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz trägt die Klägerin 83 %, die Beklagte 17 %. Die Kosten der Nebenintervention in erster Instanz trägt zu 83 % die Klägerin, zu 17 % die Streithelferin.
5.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin zu 77 %, die Streithelferin zu 23 %, mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beklagten, welche die Klägerin trägt.
6.
Das Urteil und das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20.08.13, soweit es aufrechterhalten wurde, sind ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar. Die Vollstreckungsschuldnerin kann die Vollstreckung dadurch abwenden, dass sie Sicherheit in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages erbringt, wenn nicht zuvor die Vollstreckungsgläubigerin Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Berufungsstreitwert: 28.838,51 €
Berufung der Klägerin: 13.691,06 € (Klage 5.537,81 + Widerklage 8.153,25)
Berufung der Streithelferin: 15.147,45 € (Widerklagantrag Ziff. 1: 2.975,55 + Freistellungsantrag: 12.171,90)
Gründe
I.
Die Parteien streiten um die Schadhaftigkeit eines von der Klägerin bearbeiteten Gussasphaltbodens in der Bäckerei der Streithelferin. Die Klägerin macht insofern ihre Werklohnforderung aus der Schlussrechnung vom 29.09.2011 mit 18.164,00 € geltend. Kurze Zeit nach Inbetriebnahme des Cafés löste sich die mit dem Material "Schukolin" aufgebrachte Oberflächenbehandlung des Bodenbelages ab. Nachdem die Beteiligten des Rechtsstreites eine Einigung über die Ursachen und Verantwortlichkeiten dieses Mangels nicht erzielen konnten, ließ die Streithelferin einen Fliesenbelag aufbringen. Die Beklagte macht Mangelbeseitigungskosten in Höhe von 35.926,87 € in der Weise geltend, dass sie mit der Werklohnforderung, insoweit diese unstreitig ist, d. h. in Höhe von 12.626,17 €, aufrechnet und den überschießenden Betrag mit der Widerklage begehrt (23.300,70 €). Dabei wird differenziert zwischen einem Einbehalt, den die Streithelferin an der Rechnung der Beklagten vorgenommen hat (auf Zahlung von 11.128,80 € gerichteter Widerklagantrag Ziff. 1), und dem weitergehenden Betrag in Höhe von 12.171,90 €, der von der Streithelferin gegenüber der Beklagten geltend gemacht wird (auf Freistellung gerichteter Widerklagantrag Ziff. 2).
Das Landgericht wies die Klage auf Werklohn ab und gab der Widerklage zum Teil, d. h. in Höhe von 8.153,25 €, statt. Zur Begründung führte das erstinstanzliche Gericht aus, die Werklohnforderung der Klägerin beschränke sich auf 12.626,19 €.
Die Leistung der Klägerin sei mangelhaft gewesen. Der Sachverständige habe ausgeführt, dass der von der Klägerin verwendete Oberflächenauftrag mit Schukolin lediglich eine Dispersion darstelle, nicht jedoch die vertraglich geschuldete Versiegelung des darunter liegenden Gussasphalts. Dass die Verwendung des Materials Schukolin von der Beklagten vorgegeben worden sei, sei nicht nachgewiesen worden.
Die Beklagte könne Ersatz der Nachbesserungskosten gemäß § 4 Nr. 7 VOB/B verlangen. Das Werk sei noch nicht abgenommen. Da die Klägerin mit Schreiben vom 28.11.2011 (Anl. K 3) die Mangelbeseitigung ernsthaft und endgültig verweigert habe, bedürfe es weder einer Fristsetzung noch der Auftragsentziehung. Die Fremdnachbesserungskosten seien allerdings nicht anhand der Herstellung eines Fliesenbodens zu bestimmen, da es durchaus möglich gewesen sei, den ungeeigneten Oberflächenauftrag abzuschleifen und den Boden anschließend zu versiegeln. Eine derartige Herstellung einer neuer Versiegelung verursache Kosten in Höhe von lediglich 20.779,35 €. Nach Aufrechnung mit der Hauptforderung stehe der Beklagten noch ein Betrag in Höhe von 8.153,25 € zu.
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Sie lässt vorbringen, sie habe ihre Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt. Zwar hätten die Parteien eine förmliche Abnahme vereinbart, im Anschluss durch Ingebrauchnahme jedoch darauf verzichtet. Darüber hinaus sei die förmliche Abnahme aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Beseitigung des klägerischen Gewerkes durch die Streithelferin unmöglich geworden. Der Werklohn sei damit fällig.
Die Werkleistung sei nicht mangelhaft erbracht worden. Der Sachverständige habe ausgeführt, dass Schukolin für das konkrete Bauobjekt bei entsprechender Pflege geeignet sei. Zu Unrecht sei das Landgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin die geschuldete Versiegelung nicht erbracht habe. Der Sachverständige habe ausgeführt, dass der Begriff der Versiegelung durchaus unterschiedlich verstanden werden könne. Vom Hersteller werde Schukolin zur Bodenversiegelung angeboten.
Dem entsprechend beantragt die Klägerin,
Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20.08.2013 abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 18.164,00 € nebst 8 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 31.10.2011 zu zahlen,
die Widerklage abzuweisen.
Dem gegenüber begehrt die Streithelferin:
Das Urteil des Landgerichts Stuttgart wird abgeändert und wie folgt neu gefasst:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte 11.128,80 € nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 05.05.2012 zu bezahlen.
3.
Die Klägerin wird verurteilt, die Beklagte von einer weitergehenden Forderung der Streithelferin Ziff. 1 aus dem Einbau einer für die Bäckerei, Konditorei und Café ungeeigneten Beschichtung, soweit diese 12.626,17 € nebst Zinsen übersteigt, freizustellen.
Die Streithelferin will mit ihrer Berufung eine vollständige Berücksichtigung der Widerklage erreichen. Die Klägerin habe auf die mit Schriftsatz vom 16.05.2013 veranlasste Vorlage der Anl. B 7 (Zusammenstellung zur Höhe der Mangelbeseitigungskosten) nicht mehr reagiert. Sie habe sich als Fachunternehmen angesichts dieses detaillierten Vortrages jedoch nicht auf ein einfaches Bestreiten beschränken dürfen. Damit sei der Vortrag der Beklagten zur Notwendigkeit und Angemessenheit der Mangelbeseitigungskosten als zugestanden anzusehen gemäß § 138 Abs. 3 ZPO.
Tatsächlich sei eine Nachbearbeitung des Bodens durch Abschleifen und Neuversiegelung nicht möglich gewesen. Die Streithelferin habe diesbezüglich bei zwei Fachunternehmen angefragt (K und S), die diese Arbeiten als unmöglich bzw. wegen des sehr ungewissen Erfolgs abgelehnt hätten. Deshalb und wegen des vorhandenen Zeitdruckes sei das Verfliesen sowohl technisch als auch ökonomisch die einzige vernünftige Vorgehensweise gewesen.
Zur Höhe der Mängelbeseitigungskosten im Einzelnen sei vorzutragen: Insofern das Landgericht bei einzelnen Positionen diese aufgrund eigener Sachkunde geschätzt habe, sei festzuhalten, dass das Gericht eben nicht über eigene Sachkunde verfüge. Das Fehlen von Darlegungen zur eigenen Sachkunde im Urteil und in dem erforderlichen vorherigen Hinweisbeschluss stelle einen Verstoß gegen § 286 Abs. 1, § 139 ZPO dar.
Zu Pos. 14 (aus Anl. B 7): Wegen der Malerarbeiten sei die Abrechnung mit zugehörigen Rapporten vorgelegt worden. Beim Anschleifen von Gussasphalt sei Staubbildung und eine daraus resultierende Verschmutzung der Wände nicht zu vermeiden. Nachdem es sich um repräsentative Räumlichkeiten eines Geschäftslokales handele, sei nicht nur der Sockelbereich, sondern die Wand jeweils bis auf Deckenhöhe zu streichen gewesen.
Zu Pos. 15: Die Überarbeitung der elastischen Fuge sei entgegen der Annahme des Landgerichts nicht nur wegen des Fliesenbelages notwendig geworden, eine solche Verfugung gebe es vielmehr auch zwischen dem Gussasphalt und den angrenzenden Wänden. Die Fugen hätten mithin in jedem Fall überarbeitet werden müssen.
Zu Pos. 13: Bis zum Abschluss der Nachbesserungsarbeiten habe der vorhandene Bürocontainer weiterhin als provisorisches Büro genutzt werden müssen. Dies sei billiger gewesen, als den vorhandenen Container erst zurückzugeben, um ihn dann für die Dauer der Nachbesserungsarbeiten erneut anzumieten verbunden mit dem Aufwand für das Ein- und Ausräumen des Büros.
Zu Pos. 10: Ein 5 m x 5 m großer Textilbelag im Loungebereich habe ausgetauscht werden müssen, weil durch Schuhe aufgetragene Reste der Versiegelung bzw. des Gussasphalts diesen Bodenbelag verklebt und verschmutzt hätten.
Zu Pos. 17: Der Architekt habe Anspruch auf zusätzliches Honorar, da die Ausführungsfehler der Klägerin eine Umplanung und teilweise Wiederholung der Grundleistung Objektüberwachung notwendig gemacht hätten.
Die Beklagte beantragt:
Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
Sie bringt vor, die Klägerin könne rechnerisch allenfalls 12.626,17 € verlangen. Da ein Berufungsvorbringen zum weitergehenden Werklohnanspruch nicht vorliege, sei die Berufung insoweit unzulässig.
Bei dem Material Schukolin handele es sich um eine Pflege, nicht aber die geschuldete Versiegelung. Das von der Klägerin eingesetzte Material sei mithin ungeeignet, ihr Werk mangelhaft.
Wegen des weiteren Sachvortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.03.14 verwiesen.
II.
1. Die Berufung der Klägerin ist in Höhe von 5.537,81 € mangels Begründung bereits unzulässig.
Die Berufungsbegründung befasst sich allein mit der umstrittenen Mangelhaftigkeit der Bodenversiegelung. Die in erster Instanz darüber hinausgehend erörterte Problematik der Höhe des Werklohns (strittiges Aufmaß, Kosten für Anfahrt und Baustelleneinrichtung, Mehraufwand für Bearbeitung von Lunkern und Fehlstellen, Behinderungskosten wegen ungenügender Räumung des Bodens) wird in der Berufungsbegründung nicht angesprochen. Insofern fehlt es an der nach § 520 Abs. 1, Abs. 3 ZPO obligatorischen Berufungsbegründung. Der bloße stereotype Verweis auf den gesamten erstinstanzlichen Sachvortrag am Ende der Berufungsbegründung reicht nicht aus, um diese Streitpunkte zum Gegenstand des Berufungsverfahrens zu machen. Streitgegenstand der Berufungsinstanz ist daher allein die Mangelhaftigkeit des Bodens und daraus fließende Ansprüche der Beklagten. Die Höhe des Werklohns steht damit in dem vom Landgericht festgestellten, unstreitigen Umfang (12.626,19 €) fest. Insofern der Berufungsantrag eine Erhöhung der Werklohnforderung auf 18.164 € begehrt, ist die Berufung mangels Begründung bereits nicht zulässig, so dass sie insoweit zu verwerfen ist.
2. Die Berufung der Streithelferin ist vollumfänglich zulässig. Ein Streithelfer ist zur Einlegung eines Rechtsmittels auch dann befugt, wenn die von ihm unterstützte Hauptpartei selbst kein Rechtsmittel eingelegt hat. Dabei gilt für den Streithelfer die Rechtsmittelfrist der unterstützten Partei (BGH NJW 90, 190), was sich vorliegend nicht auswirkt, da das erstinstanzliche Urteil der Streithelferin und der Beklagten am selben Tag zugestellt wurde (26.08.13).
3. Der Werklohn ist wegen Übergang in ein Abrechnungsverhältnis fällig, auch ohne dass es einer Abnahme bedarf. Die Beklagte fordert von der Klägerin keine Vertragserfüllung mehr, sondern macht nur noch Gewährleistungsansprüche in Form des Ersatzes angefallener Mangelbeseitigungskosten geltend. Sie darf sich daher nicht mehr auf die fehlende Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung berufen.
4. Das Werk der Klägerin ist mangelhaft, da die Behandlung des Bodens mit Schukolin keine Bodenversiegelung im vertraglich geschuldeten Sinne darstellt.
Nicht angegriffen wird in diesem Zusammenhang die Feststellung des Landgerichts, es sei nicht nachgewiesen worden, dass die Beklagte das verwendete Schukolin vorgegeben habe. Es ist daher für die Berufungsinstanz davon auszugehen, dass die Auswahl des Versiegelungsmaterials durch die Klägerin erfolgte.
Der Vertragsinhalt bestimmt sich nach dem Angebot der Beklagten (ausgefülltes Leistungsverzeichnis Bl. 54 d. A.), welches die Klägerin mit Schreiben vom 28.07.11 (Anl. K 1, hinter Bl. 3 d. A.) annahm. Danach schuldete die Beklagte im Hinblick auf den Boden aus Terrazzo-Gussasphalt das mehrmalige Schleifen der Gussasphaltfläche, die Spachtelung zum Verschließen von Poren und Schleifausbrüchen sowie eine abgestuft nach Rutschhemmklassen zu erfolgende "Oberflächenversiegelung". Nähere Ausführungen zur Art der Versiegelung, insbesondere zu dem zu verwendenden Versiegelungsmaterial, enthält der Vertrag nicht.
Der Sachverständige Dr. S erstattete sein Gutachten mündlich anlässlich eines vom Landgericht ausgeführten Ortstermins (Protokoll vom 28.05.13) und wurde vom Senat erneut ergänzend angehört (Protokoll vom 24.03.14). Nach seinen Ausführungen gilt es drei Arten der Oberflächenbehandlung zu unterscheiden:
die Beschichtung: Reaktionsharzmaterial von mindestens 1 mm
die Versiegelung: Reaktionsharzmaterial von ca. 0,3 - 0,5 mm Stärke
die Dispersion: 0,1 bis 0,2 mm Stärke.
Während Beschichtung und Versiegelung aus Zweikomponentenmaterialien bestehen, die durch chemische Reaktion mit einander ein dreidimensionales Netzwerk, also ein Stück Boden, bilden und dauerhaft haltbar sind (10 bis 15 Jahre), ist eine Behandlung mit Dispersionsfarbe etwas grundsätzlich anderes: Dadurch entsteht ein wenig stabiler Auftrag, der regelmäßig neu einzupflegen ist (je nach Nutzungsintensität alle 2 Wochen bis 6 Monate).
Diese Darstellung des Sachverständigen steht im Einklang mit dem allgemeinen Sprachverständnis, wonach der Begriff "Versiegelung" ein dauerhaftes Element beinhaltet, das über einen bloßen Überzug, der sich in relativ kurzer Zeit abnutzt und deshalb ständig zu erneuern ist, hinausgeht.
Das verwendete Schukolin ist nach Auffassung des Sachverständigen zwar grundsätzlich für den Auftrag auf Gussasphalt geeignet. Schukolin ist allerdings kein Reaktionsharzmaterial und verfügt nur über eine geringe Schichtdicke (0,05 mm), so dass hier eine regelmäßige Einpflegung stattfinden muss. Es handelt sich mithin nach den oben dargestellten Ausführungen des Sachverständigen nicht um eine Versiegelung.
Richtig ist, dass der Begriff der Versiegelung branchenabhängig unterschiedlich verstanden wird. Wie der Sachverständige vor dem Senat ausführte, kann es z. B. im Bereich der Bodenreinigung durchaus ein anderes Verständnis geben. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es im hier zur Entscheidung anstehenden Fall konkret gerade nicht um Reinigungsarbeiten, sondern die Bodenherstellung ging. Es ist daher das Verständnis der Bodenherstellerbranche zugrundezulegen, der auch die Klägerin als Fachfirma angehört. Nach dem Empfängerhorizont dieser Fachkreise wird unter einer Versiegelung eine Behandlung mit Reaktionsharzmaterial verstanden, wie der Sachverständige vor dem Senat unter ergänzendem Hinweis auf das Merkblatt des Bundesverbands Estrich und Beläge nachvollziehbar ausführte. Auch im technischen Merkblatt des Herstellers H (Anl. K 4) wird der Begriff der Versiegelung nicht verwendet, lediglich die dem Internet entnommene Werbedarstellung zur Schukolin-Serie steht unter dem Überbegriff "Bodenversiegelung" (Bl. 222 d. A.).
Darüber hinaus ist bei der Auslegung des vertraglich Geschuldeten auch der Leistungszweck zu berücksichtigen. Der aufgebrachte Bodenbelag sollte bekannterweise für einen Cafébetrieb tauglich sein. Die mit einer Dispersion verbundene Notwendigkeit der steten Neueinpflege in kurzen Abständen ist hierfür aber wenig zweckmäßig. Der Sachverständige führte vielmehr anschaulich aus, zu welchen Problemen dies in der praktischen Handhabung führen kann: Wo Fett- und Ölhaltiges zu Boden fällt, muss sehr häufig wieder eingepflegt werden. Da der Boden keine gleichmäßige Abnutzung erfährt, nutzt sich die Dispersionsschicht unterschiedlich schnell ab. Bei der Neueinpflege darf aber nicht gleichmäßig der gesamte Boden bearbeitet werden, weil bei weniger abgenutzten Stellen sonst die Gefahr der Glättebildung besteht. Es müsste deshalb bei jeder Neueinpflege differenziert werden zwischen weniger und stärker abgenutzten Stellen, was - so der Sachverständige ausdrücklich - in der Praxis nur schwer möglich ist. Auch unter dem Gesichtspunkt der Tauglichkeit für den angestrebten Verwendungszweck eignet sich ein Schukolinauftrag daher nicht.
Die vertragliche Anforderung ("Oberflächenversiegelung") ist damit nicht gegeben, das Werk ist mangelhaft, da es sich zwar grundsätzlich für die Aufbringung auf Gussasphalt eignet, aber nicht die von den Parteien vereinbarte Eigenschaft aufweist, weil es nicht zu einer Versiegelung des Bodens führt.
5. Bei der Höhe der aufzuwendenden Mangelbeseitigungskosten dürfen die Kosten der Verfliesung zugrunde zu legen. Eine Bearbeitung des Bodens durch Neuversiegelung ist für die Beklagte nicht zumutbar, da sie mit nicht unerheblichen Risiken behaftet wäre.
Insoweit das Landgericht aus eigener Sachkunde zur Auffassung gelangte, eine Neuversiegelung sei unproblematisch möglich, rügt die Beklagte zu Recht, dass nähere Ausführungen dazu fehlen, woher der Richter diese Sachkunde bezieht. Grundsätzlich macht eine eigene Sachkunde des Richters die Einholung eines Sachverständigengutachtens entbehrlich. Das Gericht muss (BGH NJW 00, 1946 [BGH 21.03.2000 - VI ZR 158/99]) seine Kenntnisse jedoch im Einzelnen darlegen; die bloße Behauptung eigener Sachkunde reicht nicht aus. Vor diesem Hintergrund war der Senat gehalten, die Frage der geeigneten Art der Mangelbeseitigung durch die erneute Anhörung des Sachverständigen aufzuklären.
Der Sachverständige führte nachvollziehbar aus, dass das Schukolin zwar unschwer vom Boden abgereinigt, jedoch nicht mehr aus den Poren des Gussasphalts entfernt werden kann. Da Schukolin wie ein Trennmittel wirkt, entstehen an diesen Stellen Haftungsprobleme für die neue Versiegelung. Wegen dieser Ungewissheit des Erfolgs einer Neuversiegelung durfte die Beklagte als Auftraggeberin eine Vorgehensweise wählen, die den Mangel sicher beseitigte. Dies sind z. B. Fliesen, weil sie selbst tragfähig sind, auch wenn der Untergrund nicht vollständig haftfähig ist.
6. Die von der Beklagten im Einzelnen geltend gemachten Kosten ergeben sich aus der Aufstellung in Anl. B 7. Dem erstinstanzlichen Gericht lag diese Anlage nicht vollst�ändig vor. Vielmehr war zunächst mit Schriftsatz der Streithelferin vom 05.11.12 (Bl. 24 d. A.) lediglich das zusammenfassende Deckblatt vorgelegt worden. Mit Schriftsatz vom 16.05.13 (Bl. 88 d. A.) übersandte die Streithelferin Anl. B 7 für die Klägerin "nochmals" als "komplette Anlage mit allen Belegen". Diese Anlage wurde bestimmungsgemäß der Klägerin weiterversandt, so dass in der Akte nur das Deckblatt verblieb.
Unter Verwertung der in zweiter Instanz erneut komplett vorgelegten Anlage B 7 ergibt sich im Einzelnen folgende Berechtigung der mit der Widerklage verlangten Kosten:
a) Berechtigt sind die Positionen 1 bis 2a der Anl. B 7 mit 11.531,07 €. Hierbei begehrt die Beklagte die Kosten des Abschleifens und Absaugens des Gussasphalts sowie Restarbeiten der Verfliesung. Die eigentlichen Verlegearbeiten der Fliesen sowie der Materialaufwand der Fliesen werden dagegen nicht eingefordert. Der Anfall dieser Kosten ist belegt durch die Rechnungen der Fa. E vom 23.03.12 und 28.08.12. Dabei werden neben den Schleif- und Absaugkosten die Beseitigung von Bodenunebenheiten vor der Verfliesung sowie im Wesentlichen der Aus- und Wiedereinbau von Türen abgerechnet. Diese Arbeiten sind sämtlich durch detaillierte Rapportzettel im Einzelnen nachvollziehbar dargestellt. Auch der Zuschlag für Arbeiten nach 18h00 ist geschuldet. Die Beklagte durfte nach Feierabend arbeiten lassen, um so - auch zum Vorteil der Klägerin - höhere Schäden zu vermeiden, die eine Schließung des Betriebs mit sich gebracht hätte.
b) Ebenso berechtigt ist die durch die Verfliesung notwendig gewordene Aufdoppelung der metallenen Treppenstellstufen bzw. der Höhenausgleich der Eingangsmatte (Pos. 3 aus Anl. B 7), wozu die Rechnung der Fa. D vom 24.08.12 mit 5.257 € vorgelegt ist.
c) Es bestand das Erfordernis, einzelne Türen zu kürzen wegen des durch die Fliesen erhöhten Bodenaufbaus. Berechtigt ist daher auch der Rechnungsbetrag der Fa. H vom 31.05.12 mit 645 € (Pos. 4 aus Anl. B 7).
d) Es bestand die Notwendigkeit, die vorhandene Küche aus- und wiedereinzubauen, um den darunter befindlichen Boden zu fliesen, weshalb die mit Rechnung der Fa. B vom 27.08.12 angefallenen 898,35 € (Pos. 5) zu ersetzen sind.
e) Was den eigenen Arbeitsaufwand der Streithelferin anbelangt (Zusammenstellung in Pos. 6), ist dieser unter leichten Abzügen, nämlich in Höhe von 2.070 € anstelle geltend gemachter 2.265 €, berechtigt. Die Streithelferin hat detailliert dargestellt, welcher ihrer Mitarbeiter wann welche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Mangelbeseitigung ausführte. Im Wesentlichen ging es um Putz- und Räumarbeiten während der Fliesenverlegung. Da die Fliesenarbeiten abends erfolgten, mussten morgens vor Geschäftseröffnung die Räumlichkeiten wieder soweit in Ordnung gebracht werden, dass der Cafébetrieb aufgenommen werden konnte. Abends waren entsprechend in Vorbereitung für die Handwerker Gegenstände aus den Caféräumen zu entfernen. Diese Mängelbeseitigungsarbeiten im eigentlichen Sinn sind erstattungsfähig. Nicht zu ersetzen sind dagegen die unter dem Stichwort "Stromausfall" angegebenen Stunden (jeweils eine halbe Stunde am 03.03., 06.03. und 11.03.12), weil insofern ein Zusammenhang mit der Mangelbeseitigung nicht ersichtlich ist. Ebenfalls nicht anerkannt werden konnte die grundsätzlich nicht erstattungsfähige eigene Mühewaltung der Streithelferin; dies betrifft je eine Stunde für Einweisung und Schlüsselübergabe am 03.03. und 04.03 sowie für die Teilnahme an einer Besprechung mit dem Architekten am 16.03.12.
Die genaue Addition der von der Streithelferin aufgezählten Stunden ergibt 73,5 (geltend gemacht werden "ca. 75,5"). Hiervon sind wie dargestellt die nicht erstattungsfähigen 4,5 Stunden in Abzug zu bringen, so dass im Ergebnis noch 69 Stunden verblieben.
Gegen den begehrten Stundensatz von 30 € bestehen im hiesigen Sachverhalt deshalb keine Bedenken, weil es sich um Tätigkeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten handelte, die auch bei Fremdvergabe entsprechend teurer zu vergüten gewesen wären. Zu bezahlen sind auf diese Position im Ergebnis daher 30 € x 69 = 2.070 €.
f) Berechtigt sind auch die Kosten der Grundreinigung laut Rechnung der Fa. B vom 27.08.12 mit 944 € (Pos. 9). Hier handelte es sich um die nach Durchführung der Malerarbeiten im August 2012 vorgenommene, professionelle Reinigung der Räume.
g) Nicht ersatzfähig sind dagegen die aus der Rechnung der Fa. H vom 30.09.11 geltend gemachten 1.154,30 € für den Ersatz eines Teppichbodens. Die Leistungserbringung durch die Klägerin erfolgte im September 2011; die Verlegung des Teppichbodens durch Fa. H fand ausweislich des Rechnungstexts im gleichen Zeitraum statt. Zu diesem Zeitpunkt war weder der Mangel am Boden gerügt, noch fanden bereits Mangelbeseitigungsarbeiten statt. Die vorgelegte Rechnung der Fa. H kann sich daher nicht auf den beklagtenseits behaupteten Austausch eines Teppichbodens im Zuge der Mängelbeseitigung beziehen.
h) Ebenfalls nicht anerkannt werden können die Rechnungen der Fa. K über 1.009,72 € und 343,55 € (Pos. Nr. 11 und 12 der Anl. B 7). Während die Beklagte vortragen lässt, während der Mängelbeseitigungsarbeiten hätten Staubschutzwände aufgestellt werden müssen, betreffen diese Rechnungen anderes. Dort wurden Schallschutzwände bereitgestellt unter dem Stichwort "Schallschutzmaßnahme Tiefgarage". Auch die Rechnungsfreigabe des Architekten trägt die Überschrift "Schallschutz Sanierung". Es ist nicht ersichtlich, wie Schallschutzmaßnahmen in der Tiefgarage durch die Verfliesungsarbeiten des Bodens notwendig geworden sein könnten.
i) Die Bereitstellung eines Bürocontainers (Pos. 13) über einen Zeitraum von sechs Monaten, konkret vom Oktober 2011 bis zum März 2012, wird von der Beklagten damit gerechtfertigt, dass das Belassen des ohnehin schon vorhandenen Containers im Ergebnis preiswerter gewesen sei, als diesen abholen zu lassen, um ihn punktuell im März 2012, als die Mängelbeseitigungsarbeiten durchgeführt wurden, erneut anliefern zu lassen. Diesem Vortrag hat die Klägerin nicht widersprochen. Die Rechnung der Fa. W vom 02.10.12 über 900 € ist daher erstattungsfähig.
j) Auch die Malerarbeiten (Pos. 14) aus der Rechnung der Fa. R und F vom 21.08.12 mit 5.360,51 € sind zu ersetzen. Es mag durchaus zutreffen, dass bei den Mängelbeseitigungsarbeiten die Wände nur im Sockelbereich beeinträchtigt wurden. Allerdings ist der Streithelferin zuzugestehen, die Wände in den der Kundenöffentlichkeit zugänglichen Bereichen komplett streichen zu lassen, so dass sich ein einheitliches Erscheinungsbild ergibt.
j) Die Kosten der elastischen Fugenausbildung (Pos. 15) sind als notwendige Begleitarbeit der Fliesenverlegung erstattungsfähig. Die Höhe ergibt sich aus der Rechnung der Fr. K vom 28.08.12 mit detailliertem Aufmaß (1.634,38 €).
k) Zu begleichen sind auch die durch den Aus- und Einbau von LED-Leuchten bei der Bearbeitung der Trittstufen angefallenen Kosten aus der Rechnung der Fa. M mit 238 € (Pos. 16 der Anl. B 7).
l) Nicht erstattungsfähig sind die für die Inanspruchnahme eines Architekten angefallenen Kosten (Rechnung P + P vom 08.10.12 über 3.745,99 €). In diesem Zusammenhang verwies das Landgericht zutreffend darauf, dass der auch mit der Objektüberwachung und -betreuung (Leistungsphase 8 und 9 der HOAI) der klägerischen Arbeiten betraute Architekt Mängelbeseitigungsarbeiten, welche in Bezug auf das klägerische Werk notwendig werden, ohne zusätzliche Vergütung zu begleiten habe. Dies gilt auch dann, wenn - wie hier - die Mängelbeseitigung aus Gründen der technischen Notwendigkeit in anderer Weise zu erfolgen hat wie das ursprünglich ausgeführte Werk.
Zusammenfassend ergeben sich Ansprüche der Beklagten für die Mangelbeseitigung in Höhe von 29.478,31 €, wovon 12.626,17 € durch die Aufrechnung mit dem Werklohnanspruch der Klägerin abgegolten sind. Der verbleibende Restbetrag von 16.852,14 € war aufzuteilen auf den Widerklagantrag Ziff. 1 (Zahlungsanspruch in Höhe von 11.128,80 €) und den Widerklagantrag Ziff. 2 (Freistellungsverlangen) mit 5.723,34 €.
Im Hinblick auf die Begründung der Zinsentscheidung kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil verwiesen werden.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92 Abs. 1, 97, 101 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit fußt auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die hierfür erforderlichen Voraussetzungen aus § 543 ZPO nicht vorlagen.